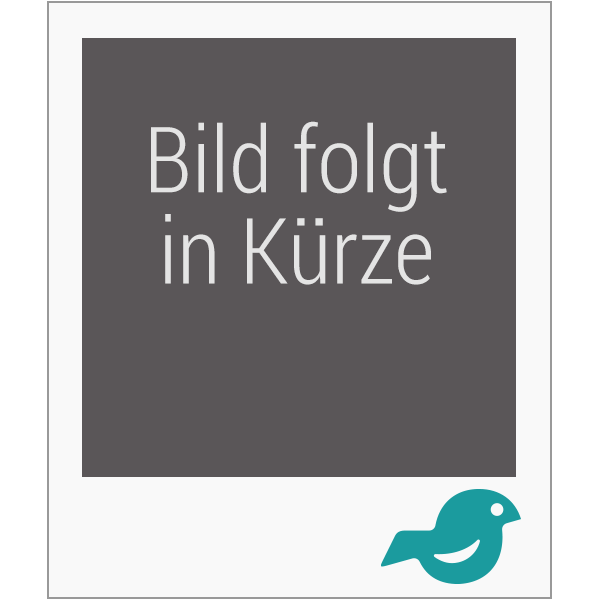Produktdetails
- Verlag: Ammann
- ISBN-13: 9783250102212
- Artikelnr.: 05293693
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Im Volkston: Einhundertvierundvierzig Vierzeiler von Fernando Pessoa / Von Max Grosse
Faßt man mit Hegel die Lyrik als jene literarische Gattung auf, in der sich ein Subjekt selbst ausspricht, dann stürzt einen das Werk von Fernando Pessoa zunächst einmal in heillose Verwirrung. Denn der größte portugiesische Dichter unseres Jahrhunderts verfügt über gleich mehrere, klar charakterisierte und gegeneinander abgegrenzte Subjektivitäten. Jedes seiner Ichs besitzt eine ihm eigentümliche Erfahrungs- und Ausdruckswelt. Der bereits 1915, also zwanzig Jahre vor seinem Schöpfer, verstorbene Alberto Caeiro lebt auf dem Lande, besingt in Walt Whitmans freien Versen die einfachen Dinge und huldigt einer pantheistischen Naturfrömmigkeit.
Dagegen hält sich sein Schüler, der in England ausgebildete Schiffsingenieur Ivaro de Campos, in Lissabon auf. Im Todesjahr des Meisters Caeiro debütiert er in der Avantgarde-Zeitschrift "Orpheu" mit futuristischer Großstadtlyrik. Den Arzt Ricardo Reis hat das politische Exil nach Brasilien verschlagen, wo er klassizistische Oden in der Nachfolge von Horaz verfaßt. Zu diesen drei wichtigsten Masken treten noch mehrere Dutzend anderer Namen, die Pessoa sich dann überstülpte, wenn er nicht gerade unter seinem eigenen dichtete.
In dem berühmten Brief an Adolfo Casais Monteiro vom 13. Januar 1935 analysiert der Proteus der Moderne das tief in seiner Psyche wurzelnde Maskenspiel so hellsichtig und distanziert, als spreche er von einem Fremden: "Der geistige Ursprung meiner Heteronyme beruht auf meiner angeborenen, beständigen Neigung zur Entpersönlichung und Verstellung. Diese Phänomene haben sich - zu meinem und meiner Mitmenschen Glück - in mir vergeistigt; das heißt, in meinem praktischen äußeren Leben und im Umgang mit anderen treten sie nicht in Erscheinung; sie explodieren nach innen, und ich trage sie mit mir allein aus."
Allerdings nutzte Pessoa zum Urlaub vom Selbst nicht bloß die Heteronyme; eine weitere Möglichkeit bot das Abtauchen ins Anonyme, in die Volkspoesie. Vor dreißig Jahren beförderten Georg Rudolf Lind und Jacinto do Prado Coelho aus der mythischen Truhe, welche den riesigen unveröffentlichten Nachlaß des Dichters in sich barg, 325 Strophen im Volkston ans Licht. Lind hatte auch damit begonnen, eine Auswahl dieser Verse ins Deutsche zu übertragen und auf diese Weise die von ihm bei Ammann veranstaltete Werkausgabe um eine weitere Facette zu bereichern. Seit seinem Tod im Jahre 1990 setzt seine Frau Josefina die gemeinsame Arbeit alleine fort, so daß jetzt "144 Vierzeiler" in deutscher Übersetzung vorliegen.
Volkstümlich ist an ihnen zunächst einmal die metrische Form, welche sich in der mündlich überlieferten Dichtung, in Romanzen und in Fados großer Beliebtheit erfreut. Die Strophen umfassen jeweils vier siebensilbige Verse, von denen der zweite und der vierte immer, der erste und der dritte nur manchmal miteinander reimen: "Die Nelke, die du mir gegeben, / War aus rosa Seidenpapier. / Viel schöner wär' es gewesen, / Hättst Liebe mir gegeben dafür." Der Einschnitt nach den ersten beiden Versen trennt hier wie so häufig die beiden Pole eines mal nur angedeuteten, mal ausdrücklichen Vergleiches.
Obwohl weibliche Tücke und Flatterhaftigkeit allerhand Anlaß zur Klage geben, so versetzt doch gelegentlich der vollkommene Augenblick einer anmutigen Bewegung den Betrachter in helles Entzücken, etwa wenn ein dunkler Seidenschal gerichtet oder ein Taschentuch aufgelesen wird: "Alle Tage muß ich denken, / Mit welch reizender Gebärde / Du das Tüchlein aufgehoben, / Das vergessen auf der Erde." Szenen aus dem dörflichen Leben, von Tenne und Tanzboden blitzen auf; es plätschert der Bach, die Landleute mähen das Korn oder erfrischen sich aus einem irdenen Krug; die Frauen sind mit Nadelarbeit oder dem Auszeichnen von Wäsche beschäftigt.
Aber der oberflächliche Eindruck trügt, denn zur Idylle fügen sich die ländlichen Versatzstücke bei Pessoa nie zusammen. Das Ich quält sich, weil ihm die Liebe verweigert wird, und genießt doch seine Qual: "Ich weiß wohl, daß du mich verachtest, / Aber dennoch hab' ich das gern, / Im Verachten, das du empfindest, / Bin ich deinen Gedanken nie fern." Die bei Pessoa stets vorhandene Neigung zum Paradoxen kann sich zu völliger Negativität und Irrealität steigern: "Auf dem Gut, das es niemals gegeben, / Ist ein Brunnen, den es nicht gibt. / Dort wird einmal Wasser finden, / Jemand, der dich wirklich liebt." Über Pessoas Dichtung herrscht das Als-ob; selbst sein anonymes Ich ist ständig von Auflösung bedroht: "Deine Augen verweilen traurig / Und schauen gar nichts an . . . / Ich frage mich nur, mein Liebchen, /Wie ich dies Nichts sein kann!"
Vermutlich haben die volkstümlichen Vierzeiler Pessoa während seiner ganzen Laufbahn begleitet; die wenigen datierten Blätter stammen mal aus den Jahren 1907 und 1908, als der Dichter nach dem englischen Jugendwerk in die portugiesische Sprache überwechselte, mal aus der Spätphase unmittelbar vor dem Tod. In den besten Strophen gehen moderne Verrätselung und archaische Form miteinander eine eigentümlich spannungsreiche Verbindung ein. Seitenstücke dazu finden sich höchstens in den Liedern und in den Zigeunerromanzen Federico García Lorcas, kaum aber im Westeuropa jenseits der Pyrenäen.
Daher stehen die Übersetzer vor oft unüberwindlichen Hindernissen, wenn es darum geht, Versbau, Reimschema, syntaktische Fügung und Wortsinn gleichzeitig zu respektieren, ohne daß sie sich auf dem knappen Raum ausweichende Umschreibungen erlauben könnten. Es wäre unfair, an der beachtlichen Leistung des um Pessoa hochverdienten Ehepaares Lind herumzunörgeln, obwohl die Reimsklaverei manchmal ihren Tribut fordert. So liest man beispielsweise: "Saudades - nur Portugiesen / Können fühlen sie recht, / Sie sind Besitzer dieses Wortes / Und sagen es wahrhaft und echt." Nun gibt es kaum ein Thema der portugiesischen Lyrik, das abgegriffener wäre als das der Nostalgie. Bedient Pessoa hier ein nationales Klischee? Wer auf die gegenüberliegende Seite mit dem Original blickt, dem enthüllt sich die eigentliche, die nominalistische Pointe der letzten beiden Verse: Die Portugiesen können die Sehnsucht nämlich nur deshalb so gut empfinden, weil sie dieses Wort haben, um zu sagen, daß sie Sehnsucht haben. Am Anfang ist das Wort, und erst das Wort weckt die Empfindung.
Fernando Pessoa: "144 Vierzeiler". Aus dem Portugiesischen übersetzt von Georg Rudolf und Josefina Lind. Ammann Verlag, Zürich 1995. 159 S., geb., 25,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main