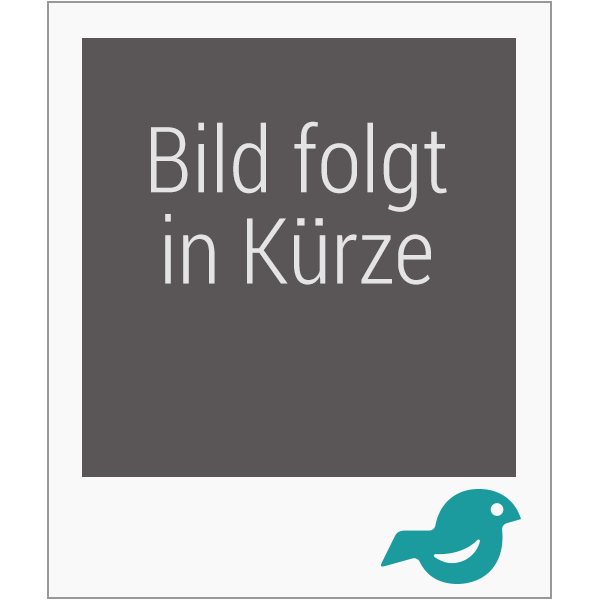Im Alten Testament ist Gott die Hauptfigur, unwandelbar und ewig, das meinen wir zu wissen. Doch Jack Miles beweist, dass sich in diesem großen literarischen Kunstwerk der Menschheit der Charakter Gottes ständig wandelt. Wann immer wir ihm begegnen, von der Genesis bis zum Buch Hiob, zeigt er ein anderes Gesicht: als Schöpfer, Zerstörer, Freund der Familie, Befreier, Henker, Feind, Zuschauer, Vater, Liebender oder Frau. Eine grandiose Idee faszinierend dargestellt: Gott als Romanheld, das Alte Testament als Geschichte seines Lebens. Am Ende ein trauriger Befund: Hiob, der von Gott Geschlagene, bringt den Herrn zum Schweigen. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist nicht beantwortet.

Allerhöchste Lehr- und Wanderjahre: Jack Miles hat eine Biographie des Herrn geschrieben / Von Jan Roß
Die Biographie Gottes von Jack Miles, die jetzt auf deutsch erschienen ist, hat in Amerika den Pulitzer-Preis gewonnen und beim Publikum großen Erfolg gehabt. Noch nie zuvor war jemand auf die Idee gekommen, aus der Bibel eine Lebensgeschichte Gottes, eine Art Bildungs- oder Entwicklungsroman des Allerhöchsten, herauszuspinnen und wie die Vita eines literarischen oder historischen Helden zu erzählen.
Wenn Gott den Mord verdammt, nachdem Kain den Abel erschlagen hat, so ist das für Miles nicht die Verkündung eines vorher schon gültigen Gebots aus gegebenem Anlaß. Sondern Gott, der sich zu diesem Thema noch gar keine Gedanken gemacht hat, bemerkt an seinem Zorn über den menschlichen Übergriff, daß er allein Herr über Leben und Tod sein will. Miles zeigt sehr schön, wie im Bericht über den ersten Brudermord Mensch und Gott gleichermaßen ratlos am Tatort stehen. Für gewöhnlich übersehen wir solche Momente der Improvisation, weil wir die Bibel unweigerlich als Ganzes vor Augen haben. Wenn Gott im ersten Buch Mose den Kain verflucht, wissen wir immer schon, daß er im zweiten Buch Mose in den Zehn Geboten den Mord verbietet, und so wirkt der Fluch über Kain ganz selbstverständlich.
Aber warum hat die Szene in der Genesis dann, wie Miles schreibt und wie es in der Tat ist, "etwas Tastendes und Versuchsweises"? So wie der Leser das nur bemerkt, wenn er sein Vorwissen über Gott beiseite läßt, wird Gottes Verhalten selbst nur begreiflich, wenn auch ihm die Zehn Gebote noch unbekannt sind, wenn er seine Entwicklung zum göttlichen Gesetzgeber noch vor sich hat. Miles liest die Bibel streng chronologisch, in der Reihenfolge ihrer Bücher, und nimmt jedes neu auftauchende Wesensmerkmal Gottes als einen neu entstandenen Charakterzug. Gott offenbart sich nicht, er erschafft und entdeckt sich. Wenn er, anders als zu Adam, Abraham oder Moses, zum Propheten Jesaja von seiner Liebe spricht, dann hat er nicht vorher von seiner Liebe geschwiegen, sondern er hat erst jetzt zu lieben gelernt.
Der Theologe Julius Wellhausen pflegte die rauhen Sitten des Herrn im Alten Testament mit der Bemerkung zu entschuldigen: "Da war der liebe Gott noch jung." Für die historische Wissenschaft war das nur eine Metapher dafür, daß das Gottesbild des alten Israel einer frühen Stufe der Religionsgeschichte angehört. Miles nimmt die Metapher wörtlich und erzählt, wie der junge Gott erwachsen wird und schließlich alt. In Deutschland mit seinem kirchenkritischen Bierernst wird gewiß gerühmt werden, wie viele Tabus Miles gebrochen und wie mutig er Dogma und Theologie gegen den Strich gebürstet habe.
Der Gott, von dem Miles handelt, ist allein der Gott des Alten Testaments, genauer: der jüdischen Bibel. Während in der christlichen Bibel das Alte Testament mit den Propheten schließt, die mit ihren Vorausdeutungen auf Christus den Übergang zum Neuen Bund bilden, stehen sie im jüdischen Kanon in der Mitte, zwischen den fünf Büchern Mose und einer etwas heterogenen Schlußgruppe, "die Schriften" genannt, in der sich unter anderem die Psalmen, das Hohelied und das für Miles besonders wichtige Buch Hiob finden.
Die Frage der Reihenfolge ist von überragender Bedeutung für eine Bibellektüre, die den Text mit gespielter Naivität vom Anfang bis zum Ende durchgeht - von einer Bedeutung, die im Hinblick auf die Überlieferungszufälle, die hinter dem einen wie hinter dem anderen Ordnungsprinzip stehen, etwas übertrieben wirkt. Das christliche Alte Testament endet mit einer Steigerung ins Offene, in eine ausstehende Zukunft, es weist über sich hinaus. Die Bibel der Juden dagegen, eigentlich das Dokument einer historischen, zeitbezogenen Religiosität par excellence, bekommt in Miles' Interpretation paradoxerweise etwas Zyklisches und Resignatives, die Heilsgeschichte schwingt in den Kreislauf einer merkwürdig leeren Zeitlosigkeit aus.
Gott "verebbt", wie Miles sich ausdrückt, er spricht in den letzten Kapiteln der Geschichte kein Wort mehr, nachdem seine ganze Identität durch die Aufführung als Willkürherrscher, die er sich im Buch Hiob geleistet hat, zweifelhaft geworden ist. Ist das noch der großzügige Weltschöpfer, der bundestreue Freund Abrahams, Jakobs und Josephs, der gerechte Gesetzgeber vom Sinai, der von der eigenen Strenge gequälte und sich zum Erbarmen bekehrende Aussender der Propheten?
Schon sehr früh, als er die Schleusen der Sintflut öffnete, hat sich in Gottes Wesen ein zerstörerischer Zug bemerkbar gemacht, aber nun, da Hiobs Frage nach einer Rechtfertigung für das Leiden des Unschuldigen unbeantwortet geblieben ist, sieht es aus, als sei das Böse in Gott ebenso mächtig wie das Gute. Er muß sich zurückziehen, damit er nicht zu genau durchschaut wird und allen Kredit verliert. Sein Volk wird in die Geschichte entlassen: "Handlungen, die einst Gott für die Juden unternommen hätte, und Aussagen, die er an sie gerichtet hätte, unternehmen und machen sie jetzt für sich selbst." Oder, andersherum, Gott wird "dem jüdischen Volk einverleibt".
Die Belastung Gottes mit dem Bösen, die ihn am Ende in solche Verlegenheit bringt, hält Miles für eine unvermeidliche Konsequenz des strikten Monotheismus: Wenn es nur einen Gott gibt, kann er das Schlechte und Verwerfliche nicht an irgendwelche Rivalen oder Widersacher delegieren. Ein Theologe würde erwidern, daß das Böse nicht in Gott liegt, sondern der Freiheit des Menschen entspringt: Wenn der Mensch mehr als ein Automat zur Befolgung von Gottes Befehlen sein soll, muß er sich auch gegen Gott entscheiden können. So kommt das Böse in die Welt, und daher besitzt es im Verhältnis zu Gott eine gewisse Selbständigkeit, die es Gott wiederum erlaubt, gut zu bleiben. Monotheismus heißt nicht, daß es außer Gott nichts gibt, sondern daß es außer Gott nichts Göttliches gibt.
Man staunt beim Lesen von Miles' Buch, wie blaß und lückenhaft die eigene Erinnerung an viele alttestamentliche Geschichten ist. Alles programmatische Interesse am Judentum, auch die Tendenz der linken politischen Theologie, das Christentum als Befreiungsreligion in die Exodustradition zurückzunehmen und so wieder zu judaisieren, haben nichts daran ändern können, daß das Alte Testament über weite Strecken ein unbekanntes Buch geblieben oder geworden ist. Jonathan, Absalom, Jephtha, Esther, Deborah und Ruth: lauter bekannte Namen und vergessene Geschichten.
Dazu die Realhistorie: Daß das alte Israel im ersten vorchristlichen Jahrtausend in ein Nordreich um Samaria und ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem geteilt war, daß 722 v. Chr. der Norden an Assyrien fiel und 587 die Babylonier Jerusalem eroberten und die Elite des Landes ins Exil verschleppten, daß diese Katastrophen den Hintergrund für das Auftreten der Propheten bilden: das alles ist wahrscheinlich weniger allgemeines Bildungsgut als der Trojanische Krieg. Insofern liegt der Reiz von Miles' Theobiographie schon allein im Stofflichen, in der Monumentalität der Geschichte, die wie in Technicolor mit Mann und Roß und Wagen am Leser vorbeizieht, im Wechsel mit Nahaufnahmen des problematischen Protagonisten. Miles' Buch steht irgendwo zwischen Cecil B. DeMilles Filmschinken "Die Zehn Gebote" und Kierkegaards "Furcht und Zittern", der bis zur Indiskretion bohrenden Ausdeutung der Geschichte von Abraham und Isaak.
Miles' Version der Heilsgeschichte sieht ketzerischer aus, als sie ist. Er selbst weist darauf hin, daß die Unveränderlichkeit Gottes, die bei ihm geleugnet wird, weniger ein biblischer als ein griechischer Gedanke ist. Für die griechischen Philosophen mußte Gott unveränderlich sein, weil alle Veränderlichkeit, Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit der antiken Weisheit als Unvollkommenheit, als Mangel an Sein und Ewigkeit galten. Einem handelnden oder gar leidenden, in irgendwelche Schicksale verstrickten Gott hätte die selige Selbstgenügsamkeit gefehlt, die für Platon und Aristoteles Inbegriff des Göttlichen war.
Dagegen ist für den biblischen Gott die Verstrickung ins Zeitliche und Vergängliche das eigentlich Charakteristische. Die ganze Mühe, die der Herr um Israels willen auf sich nimmt, das unentwegte Sichkümmern, Zürnen und Sich-wieder-versöhnen-Lassen, wäre für den "unbewegten Beweger" des Aristoteles vollkommen undenkbar. Der biblische Gott ist überraschenderweise viel menschlicher und menschenähnlicher als selbst die anthropomorphen Götter Homers mit ihren Liebschaften und Raufereien. Daher ist der respektlose Versuch, den jüdisch-christlichen Gott zu psychologisieren, ihn bei seinen Schwächen und Unfertigkeiten zu ertappen, wie ihn etwa Thomas Mann im Josephsroman oder Hans Blumenberg in seiner "Matthäuspassion" unternommen haben, zwar vielleicht ein Sakrileg, aber doch eines, zu dem die Religion selbst einlädt. Und ist es nicht allemal ein geringeres Sakrileg als die Vorstellung eines Gottes, der Mensch wird, eines Erlösers, der zugleich Gott und Mensch ist - vere deus, vere homo?
Das Problem der Menschenähnlichkeit Gottes ist der ernste theologische Kern von Miles' literarischem Versuch. Es ist zugleich das Problem der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, heißt es im ersten Buch Mose. Die aufklärerische Religionskritik, von Xenophanes bis Feuerbach, hat diesen Satz umgekehrt: Die Menschen haben Gott nach ihrem Bild, allenfalls nach ihrem Idealbild geschaffen. Indem die moderne Wissenschaft die Wandlungen der Gottesgestalt in der Bibel auf den Wandel der Glaubensvorstellungen zurückführt, auf kulturelle Einflüsse, Wanderungsbewegungen oder Handelskontakte, die das religiöse Bewußtsein geformt haben, münzt sie die religionskritische Polemik in historische Erkenntnisse um: Die Geschichte Gottes ist nur Schein, aber für den, der sie zu lesen versteht, wird dahinter die wirkliche, menschliche Geschichte sichtbar.
Miles kehrt vom aufgeklärten Standpunkt auf den biblischen zurück: Die Entwicklung, die in der Bibel stattfindet, ist nicht die Entwicklung der israelitischen Religiosität, sondern tatsächlich die Entwicklung Gottes. Daß Gott den Menschen nach seinem Bilde schafft, ist keine menschliche Projektion, es ist die entscheidende Information über Gott: Nichts Menschliches ist ihm fremd. Zwar ist das für Miles nur ein perspektivischer Trick, eine literarische Fiktion, die es ihm erlaubt, seine Biographie zu schreiben. Aber in einer Hinsicht sind der Primat Gottes und die Abhängigkeit des Menschen von ihm zweifellos real: Unsere Vorstellung von dem, was ein Charakter ist, in seinem Reichtum, seinen Widersprüchen und seiner Abgründigkeit, unser ganzer abendländisch-westlicher Begriff der Person verrät die Wirkungen jahrtausendelanger Bibellektüre und jahrtausendealter Bekanntschaft mit dem biblischen Gott, mit seinem Reichtum, seinen Widersprüchen und seiner Abgründigkeit.
In diesem geschichtlichen Sinn hat Gott den Menschen tatsächlich nach seinem Bilde geschaffen. Und wie auch immer man die Prioritätsfrage im Verhältnis von Gott und Mensch beantworten mag, die Frage, wer hier Urbild und wer Abbild ist - einer des anderen Bild und daher durch ein gemeinsames Los verbunden sind die beiden jedenfalls. Noch der hartgesottenste Atheist wird bei der Lektüre von Miles mit wachsender Unruhe spüren, daß mit dem Schicksal dieses Gottes sein eigenes auf dem Spiel steht.
Der Reiz der Gottesbiographie hängt mit dem Überdruß an einer historisch-kritischen Gelehrsamkeit zusammen, die den biblischen Stoff bis zur Unkenntlichkeit in disparates Quellenmaterial zerbröseln läßt, in Tradiertes, Redigiertes und Komponiertes, in Bearbeitungen und Bearbeitungen von Bearbeitungen. Die literarische Perspektive, die Wiederherstellung der Offenbarung als Lebensgeschichte oder Lebensroman, gewinnt diesem Faktenchaos noch einmal eine Ordnung ab. Sie stiftet Einheit und bewerkstelligt damit das, was sonst der Glaube leistete, wenn er jedem scheinbaren Umweg oder Irrweg Gottes einen heilsgeschichtlichen Sinn verlieh.
Doch bleibt etwas Unangemessenes in dieser Literarisierung. Es mag sein, daß die Komplexität von Figuren wie Shakespeares Hamlet nur aus der Komplexität des biblischen Gottesbildes zu verstehen ist, aber umgekehrt ist nicht viel für das Verständnis Gottes gewonnen, wenn man ihn mit Hamlet vergleicht. Hamlet braucht Gott, aber Gott braucht Hamlet nicht - womit die Waage von Urbildlichkeit und Abbildlichkeit sich doch nach einer Seite neigt. Selten drängt sich die dem kultivierten Menschen peinliche Einsicht, daß das Ästhetische nur etwas Vorletztes ist, so unwiderstehlich auf wie bei der Lektüre des Buchs von Miles. Ist es ein wirklich erhellender Einfall, die Heilsgeschichte zum Roman zu machen - oder ist es bloß eine schicke und eigentlich auch recht bequeme Modeidee, ein Stück Kunstgewerbe? Für den ehemaligen Jesuitenpater Miles, der es gewohnt war, die Bibel wörtlich zu nehmen, mag ihre Literarisierung eine faszinierende Sache sein; für unsere abgebrühte Kulturwelt, die sowieso alles in Anführungszeichen setzt, wäre eine wörtliche Lektüre aufregender gewesen. Die Bibel erhebt einen Wahrheitsanspruch, man kann ihn bejahen oder verneinen, aber die Ästhetisierung ist nur eine etwas feinere Art, sich vor ihm zu drücken.
Jack Miles: "Gott". Eine Biographie. Aus dem Amerikanischen von Martin Pfeiffer. Carl Hanser Verlag, München 1996. 499 S., geb., 58,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main