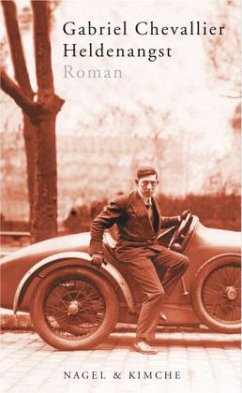Ein Antikriegsroman von 1930, dessen Neuausgabe in Frankreich 2008 hymnisch gefeiert wurde, vergleichbar mit den Werken von Remarque, Céline oder Norman Mailer: Nach dem Ersten Weltkrieg, den er als Infanterist an der Front erlebte, beschrieb Gabriel Chevallier seine Erlebnisse: Der junge Student Jean Dartemont wird eingezogen und an die Front geschickt, und dort bleibt er vier Jahre lang. Monatelang harrt er mit seinen Kameraden in den Schützengräben aus, bedroht von Kugeln, Kälte, Durchfall und grenzenloser Angst. Bei seinem Erscheinen löste der Roman seiner Direktheit wegen einen Skandal aus und wurde angesichts des neuen Krieges 1939 zurückgezogen. Jetzt ist er erstmals auf Deutsch zugänglich.

So war der Erste Weltkrieg: Gabriel Chevalliers Roman
Von Joseph Hanimann
Das Gegenecho zum Stahlgewitterrausch des Ersten Weltkriegs kam in der deutschen Literatur meist aus dem pathetischen Genre des Heimkehrerdramas, abgesehen von einigen Ausnahmen wie Bert Brecht oder August Stramm. Sarkastische Kriegsverarbeitung ist eine französische Spezialität geblieben, von Henri Barbusse bis Blaise Cendrars. Angst, Ekel, Langeweile, Panik und Tod gehören dort in den Abgrund des Daseins.
Der Plakatmaler, Kunstlehrer, Handlungsreisende und Journalist Gabriel Chevallier hatte 1925 mit dem Schreiben begonnen und wurde neun Jahre später zum Autor eines einzigen Buchs, des satirischen Romans "Cloche merle", dessen Welterfolg alle übrigen Werke überstrahlte. Auch der 1930 erschienene Kriegserinnerungsroman "La peur" geriet bald in Vergessenheit. Erst als er vor zwei Jahren in Frankreich neu aufgelegt wurde, weckte er reges Interesse. "Was haben Sie an der Front gemacht?" fragen die Krankenschwestern den verwundet ins Lazarett eingelieferten Romanhelden. Nun, er sei bei Tag und bei Nacht marschiert, ohne zu wissen wohin. Er habe exerziert, sei zu Appellen erschienen, habe Schützengräben ausgehoben, Draht und Sandsäcke transportiert, habe Hunger, Durst und Läuse gehabt. "Ist das alles?" Nun, da sei noch etwas gewesen: "Ich hatte Angst." Das Titelmotiv durchzieht auf so eindringliche Weise diesen mehr egoistisch als politisch, pazifistisch oder sonst wie idealistisch motivierten Antikriegsroman, dass er 1939, beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, zurückgezogen wurde.
Chevallier ist ein Virtuose der Situationsschilderung. Seine Wahrheiten kommen uns nicht frontal aus den Sätzen entgegen, sondern wirken szenisch diffus und doch klar in der Aussage von den Rändern her. So steht ganz Frankreich, dessen feine Gesellschaft im August 1914 gerade wie jedes Jahr in Flanellhosen und Strohhüten in den Urlaub aufbrach, am Anfang auf den Zehenspitzen schweißüberströmt in der Sonne vor den Anschlägen und liest verwundert das Wort "Mobilmachung". Krieg, das hat man ja noch nie erlebt! Geschildert wird statt patriotischer Aufregung eher eine etwas ungläubige Neugier auf etwas, was es seit über vierzig Jahren nicht mehr gegeben hatte. Auch der junge Romanheld, der zuvor der Armee zu entgehen suchte, meldet sich freiwillig zum Kriegsdienst - nicht aus Überzeugung, Opferbereitschaft oder Karrieresucht, sondern um bei einem Schauspiel dabei zu sein, das ja schnell vorüber sein würde. Mitten in die Schilderung der Augenblickssituation bricht das zurückblickende bessere Wissen ein: Zwanzig Millionen Gutgläubige seien es gewesen in Frankreich, Deutschland und anderswo, "zwanzig Millionen Dummköpfe . . . Wie ich!".
Kasernenalltag, Verlegung an die Front, Einsatz, Verwundung, Genesung, Rückkehr zur Truppe bis zum Kriegsende: Diese auf eigener Erfahrung beruhenden Episoden werden von ihrer absurden Seite her erzählt, ohne den humanistisch vollen Nachhall von der Verbrüderung über die Fronten hinweg. Im Mittelpunkt steht eher das Groteske als das Unheilvolle des Kriegs. Schon in der Kaserne fehlt es an Uniformen, so dass manche Soldaten mit Ziviljoppe und Melone exerzieren, was der Disziplin wenig zuträglich ist. Die Feuertaufe im Labyrinth der Schützengräben beginnt mit nächtelangem Herumirren und immer neuen "Halt!" oder "Kehrt!". Umso drastischer wirkt die Realität des Geschützfeuers und des geschundenen Fleisches. Der erste Todeseindruck ist für den Helden eine ungesehene, in der Dunkelheit nur gerochene Leiche mit offenen Eingeweiden.
Interessant ist an diesem Buch die Beschreibung momentaner Empfindungen noch vor der Grundsatzaussage gegen oder für den Krieg. Durch Körperschmerz wird jeder zum Egoisten und das panische Wegrennen macht aus den Soldaten hellsichtige Feiglinge. Gabriel Chevallier hat diese Kleinstverschiebungen der Wahrnehmung aus der Hölle stilistisch pointiert aufgezeichnet. Treffender als "Roman" wäre daher die Gattungsbezeichnung "Bericht", denn ohne ausgearbeitete Figurenprofile schleppt das Buch mit rudimentärem Kompositionsprinzip sich der Episodenchronologie entlang einem Erzähler-Ich hinterher, der gern ins kollektive "wir" umschwenkt. Der Text bleibt unschlüssig zwischen Augenblicksschilderung und allgemeiner Betrachtung. Er ist auch nicht ganz frei von ideologischen Einfärbungen der Epoche wie einem gewissen Männerwahn. Doch fesselt das von Stefan Glock magistral übersetzte Buch wohl gerade durch diese ungefilterte Direktheit uns Urenkel der Kriegsveteranen.
Gabriel Chevallier: "Heldenangst". Roman. Aus dem Französischen von Stefan Glock. Verlag Nagel & Kimche, Zürich 2010. 427 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Der Großteil des Werks von Gabriel Chevallier ist vergessen, weil ein einziger Roman "Clochemerle", 1934 erschienen, alles andere überstrahlt. Aus dem Werkschatten gezogen hat nun der Kimche & Nagel-Verlag dieses 1930 erstmals veröffentlichte Buch über den Ersten Weltkrieg. Geschildert werden die Kriegserlebnisse eines nicht sehr heldischen Helden aus dessen öfter ins "Wir" umschlagender Perspektive. Als Romanzusammenhang funktioniert das Buch eher nicht, meint der Rezensent Joseph Hanimann, als sehr begabt erweise sich Chevallier allerdings in der Schilderung von Einzelsituationen. Die Sinnlosigkeit des Kriegs wird dabei in unheroische und "absurde" Szenen des Herumirrens und der Orientierungslosigkeit auseinandergefaltet. Kein Meisterwerk, findet der Rezensent, aber trotz mancher Schwächen aufschlussreich. Stefan Glocks Übersetzung sei im übrigen "magistral".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH