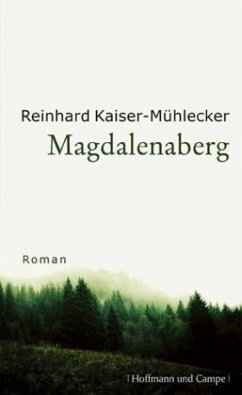Der Jürgen-Ponto-Preisträger Reinhard Kaiser-Mühlecker überzeugte 2008 mit seinem Debüt "Der lange Gang über die Stationen". Sein zweiter Roman "Magdalenaberg" erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der nach dem Tod seines Bruders ganz neu über sein Leben, seine Vergangenheit und sich selbst nachdenken muß.
Es gibt Situationen, die das Ende der Kindheit bedeuten, die einen plötzlich zu einer Entscheidung befähigen, für die man doch eben noch eigentlich nicht alt genug war. So erinnert sich Joseph, der Icherzähler in Reinhard Kaiser-Mühleckers neuem Roman, wie er nach einer Demütigung zum Pfarrer gegangen war, um ihm mitzuteilen, daß er ab jetzt nicht mehr ministrieren wird; danach war er vor den Vater getreten, um ihm diese Neuigkeit auch mitzuteilen. Und es gibt überhaupt Situationen, in denen ein Ende geschieht, das Ende einer Liebe zum Beispiel. Man sieht sich weiterhin, spricht miteinander, lebt noch zusammen, dennoch ist klar, es ist vorbei. Katharina geht und verläßt Joseph am Morgen, nachdem sie ihm endlich von Thomas erzählt hat; irgendwie war auch das Geheimnis zwischen ihnen damit verlorengegangen. Und Joseph bleibt in seinem Haus zurück, wissend um die Endgültigkeit dieses Endes, aber mit einem tiefen Erstaunen darüber, daß er nichts dagegen unternommen hatte.
Es gibt Situationen, die das Ende der Kindheit bedeuten, die einen plötzlich zu einer Entscheidung befähigen, für die man doch eben noch eigentlich nicht alt genug war. So erinnert sich Joseph, der Icherzähler in Reinhard Kaiser-Mühleckers neuem Roman, wie er nach einer Demütigung zum Pfarrer gegangen war, um ihm mitzuteilen, daß er ab jetzt nicht mehr ministrieren wird; danach war er vor den Vater getreten, um ihm diese Neuigkeit auch mitzuteilen. Und es gibt überhaupt Situationen, in denen ein Ende geschieht, das Ende einer Liebe zum Beispiel. Man sieht sich weiterhin, spricht miteinander, lebt noch zusammen, dennoch ist klar, es ist vorbei. Katharina geht und verläßt Joseph am Morgen, nachdem sie ihm endlich von Thomas erzählt hat; irgendwie war auch das Geheimnis zwischen ihnen damit verlorengegangen. Und Joseph bleibt in seinem Haus zurück, wissend um die Endgültigkeit dieses Endes, aber mit einem tiefen Erstaunen darüber, daß er nichts dagegen unternommen hatte.

Bleiben oder Gehen? Der zweite Roman des Österreichers Reinhard Kaiser-Mühlecker erzählt vom Schattenboxen mit den Zumutungen des Lebens.
Von Anja Hirsch
Wie langsam etwas fallen kann. Ein Wassertropfen, bis er Form annimmt und sich löst. "Hin und wieder schloss ich die Augen, wartete und schlug sie in dem Moment, in dem ich glaubte, der Tropfen würde sich lösen und fallen, auf." Mehr passiert zunächst nicht, außer der Beschreibung dieses absichtslosen Spiels. Man drosselt das Lesetempo, noch ehe dieser Roman in Gang gekommen ist, hypnotisiert vom müden, schweren, aber keineswegs schläfrigen Blick eines Helden, der bald gesteht, ihm sei das Zeitgefühl abhandengekommen. Gestehen wäre zu viel - er stellt es fest. Und doch geht es dann voran, nur eben in jenem langsamen Takt, den der Anfang dieses Romans vorgibt. Warum man mitgehen sollte?
Als im vergangenen Jahr "Der lange Gang über die Stationen" erschien, Reinhard Kaiser-Mühleckers Debüt, waren schnell Vergleiche zur Hand: winzige Details, als hätten die Figuren Handkes Wahrnehmungsschule genossen; eine Ruhe und ein Sprachrhythmus, als stünde der Jungbauer, dem hier Haus und Hof entgleiten, im Einklang mit der Natur; altertümelnde Satzgefüge und Beschreibungen, die an Adalbert Stifter erinnerten. Es schien, hier habe einer den Heimatroman ernst genommen. Arnold Stadler setzte sich für den Jüngeren ein. Und doch war bei aller zugeschriebenen Erblast ein eigener Ton hörbar.
Auch in "Magdalenaberg" besticht dieser zeitlupenartige, scharfgestellte, an Dingen, Vorgängen und Gesten irgendwie hängengebliebene Blick. "Ich sah ihr zu, aber begriff nichts, und dann begriff ich immer noch nicht, aber hörte auf, ihr zuzusehen." Die Geschichte, die Joseph, die Hauptfigur, hier doch selbst erlebt und erzählt, scheint sich ohne ihn zuzutragen. Katharina, die Frau, die er eine Weile liebt, ist plötzlich da, von Freunden eines Abends mitgebracht. Dann bleibt sie. Dann geht sie. Es ist die immer gleiche Geschichte vom Verlassenwerden. Und auch Joseph besingt seine Katharina an jenem ersten Abend, als würde er alles andere ausblenden, "schon damals, beim Dortsitzen, als ein anderer das unterbrochene Gespräch wiederaufnahm, wie nach Aussetzen von Musik oder Regen, langsames, zögerliches Wiedereinsetzen des Sprechens, auch am Tag danach, in der Woche danach, sogar ein Jahr danach und jetzt noch . . ." Wie unvermutet sich hier Zeiträume verengen und wieder weiten. Hier eilt keiner über die wichtigen Lebensereignisse hinweg; eher meditiert er mit ihnen.
Dies wäre reine Pose, wenn der Erzähler mit seiner permanenten Sehnsucht, "aufzugehen in der Stille", nicht zugleich in einer Biographie verwurzelt wäre, die ihn zum Vertreter einer nachrückenden, vor den elterlichen Zumutungen flüchtenden Generation macht: Aufgewachsen in Pettenbach im Almtal, das nicht nur geographisch betrachtet für Joseph "ein Übergangsort" ist, übernimmt er nicht den elterlichen Hof. Stattdessen studiert er immer lustloser in Graz, reist mit geerbtem Onkelgeld herum - und sitzt schließlich nun doch über seiner Abschlussarbeit, achtzig Kilometer entfernt vom heimatlichen Hof und genauso öde: "Ginge es hier, hielte ich es hier aus, passte ich hierher?"
Hallstatt, vor allem das Beinhaus, hatten ihn angezogen, wie ihm überhaupt Orte und Menschen eher zuzustoßen scheinen wie manchen Figuren aus der Prosa Thomas Bernhards: Man bleibt, weil die Zeit über mögliche Alternativen hinwegging. Die Geschichte über den Beruf des Instrumentenbauers bringt er aber nicht zu Papier, und auch das meint man schon oft gelesen zu haben: Wie einer, der schreiben will, darüber schreibt, dass es nicht geht. Und doch hört man hin. Denn Kaiser-Mühlecker unterhöhlt diese beiden Hauptgeschichten - Herkunft und Liebe - mit dem gleichfalls längere Zeit zurückliegenden Unfalltod des jüngeren Bruders Wilhelm, als hinge alles auf geheime Weise miteinander zusammen.
Auch Wilhelm scherte sich nicht um Hof und Eltern, weniger noch als Joseph, der immerhin mit Wehmut das allmähliche Verstummen von Vater und Mutter registriert. Erst dieses Amalgam aus drei Erzählebenen, aus Kindheit, Tod, Liebe, macht den Roman und seine vom Verschwinden bedrohte Hauptfigur zunehmend gespenstisch. Es ist, als säßen wir mit dem Erzähler auf jener Anhöhe hinter der dörflichen Kirche, die dem Roman seinen Titel gibt: Vom "Magdalenaberg", wohin Joseph früher gerne flüchtete, überblickt man nach und nach, warum einer wie er so langsam und sorgfältig erzählen muss. Und auch das Scheitern der Beziehung und des Berufs, der komplette Rückzug Josephs, erhalten oberhalb dieser Lebensplattform ihren Sinn und Tonfall.
Hier schreibt einer immerzu gegen das Verstummen an, gegen das Wegrücken von Welt. Aus diesem Schattenboxen, aus dieser leicht sedierten Prosa erwachsen, gerade wenn man nicht damit rechnet, Erinnerungskapseln und Mikroszenen voller Klarheit. Kaiser-Mühlecker bebildert eine katholische Kindheit und die Zeit vor dem Erwachen aus der provinziellen Enge, wo man noch nichts fragte, höchstens abendelang im Atlas die Topographie der Welt nachfährt; später der abrupte Entzug, nachdem "Freunde" den Jungen im Maisfeld demütigten und Joseph zum ersten Mal Pfarrer und Vater entgegentritt; und Jahre darauf, nach der Beerdigung Wilhelms, Josephs Wiedereintreten in diesen angestammten, alt gewordenen Kreis im Wirtshaus, wo er die immer gleiche Ordnung der an der Bar sitzenden "Zirbenschnapssäufer" beschreibt, als wären sie aus Holz geschnitzt. Man kennt dieses Nachhausekommen so genau: "Es war, wie es immer gewesen war. Ab und zu fiel ein Name, der in mir klang. Es kam mir friedlich vor hier, und ich vergaß fast darauf, mein Bier zu trinken. Niemand fragte mich etwas."
"Magdalenaberg" ist deshalb auch die Geschichte eines Hofkinds, das hat lernen müssen, "jede Bewegung im Augenwinkel, jede Veränderung eines Zustands sofort wahrzunehmen". Am Ende hält man die Bestandsaufnahme eines Lebensdilemmas in Händen: sich nie richtig "eingemeindet" zu fühlen und trotzdem nicht fähig zu sein, etwas verschwinden zu sehen. Kaiser-Mühlecker schreibt von diesem inneren Notstand mit sicherem Gefühl für Wiederholungen, Pausen und Beschleunigungen. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass seine Schwellengeschichte zwischen Generationen und Gleichaltrigen zugleich modern und uralt ist.
Reinhard Kaiser-Mühlecker: "Magdalenaberg". Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2009. 192 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Diese Geschichte von Herkunft, Liebe und Tod kommt Rezensentin Anja Hirsch sehr bekannt vor. Dass sie sich ihrem Sog nicht entziehen kann, liegt zum einen am langsamen Takt, dem zeitlupenartigen Tempo, mit dem der Autor Dinge, Vorgänge, Gesten und Zeiträume erfasst. Zum anderen an Reinhard Kaiser-Mühleckers altertümelnder Sprache, die die Rezensentin an Stifter erinnert. Damit dieser Sound unwiderstehlich wird und nicht Pose bleibt, hat ihn der österreichische Autor dankenswerter Weise, wie Hirsch findet, mit einer Biografie verknüpft, mit einer katholischen Kindheit in Pettenbach im Almtal und dem "inneren Notstand" zwischen Heimat und Flucht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH