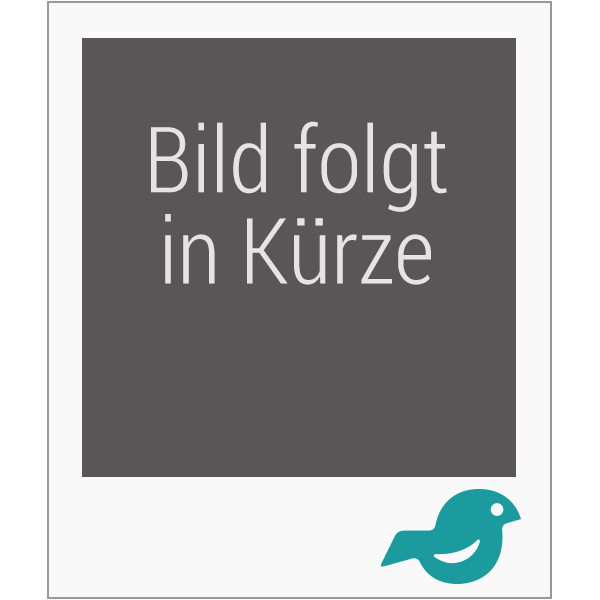Wir erfahren, wie unsere Persönlichkeit im Gehirn entsteht, wie sie bewusst und insbesondere unbewusst unsere Entscheidungen und unser Handeln lenkt. Bei Entscheidungen und Verhaltensänderungen haben die unbewussten Anteile unserer Persönlichkeit das erste und das letzte Wort, Verstand und Vernunft sind nur Berater. Der Autor erläutert, warum es schwer ist, uns selbst und andere nachhaltig zu ändern, und wie dies dennoch zu schaffen ist.

Sind manche neuen Ergebnisse der Hirnforschung in Wirklichkeit nur aufgemöbelte alte Hüte der Psychologie? Gerhard Roths neues Buch gibt Anlass zu dieser Vermutung.
Auf dem Rücken von Gerhard Roths neuem Buch steht die Frage: "Wer entscheidet, wenn ich entscheide?". Eine Frage, die in der Tat neugierig macht. Sollte sich denn darauf eine nicht banale und trotzdem sinnvolle Antwort geben lassen? Wer Roths letzte Bücher kennt, der weiß, dass dieser Autor es in ihnen mit einer solchen Antwort hielt: Nicht wir selbst treffen demnach viele Entscheidungen, sondern unser Gehirn. Und das gelte schon deshalb, weil das "Ich" selbst nichts anderes als ein Konstrukt des Gehirns sei, wie die Welt natürlich auch. Woraus zum Beispiel die abgründige Frage entstehen kann, wie die Welt nach draußen komme. Roths Antwort darauf lautete: "Sie kommt nicht nach draußen, sie verlässt das Gehirn gar nicht."
So hatte man Gerhard Roth bisher, wenn die Formulierung erlaubt ist, im Kopf. Nun aber hat er ein Buch vorgelegt, das sich von seinen vorhergehenden in mancher Hinsicht abhebt. Die denkbar grundsätzlichen Überlegungen über Konstruktionsleistungen des Gehirns werden abgelöst durch die Orientierung an recht konkreten Fragen. Die erste lautet: "Wie soll ich mich entscheiden. Soll ich eher meinem Verstand oder eher meinen Gefühlen folgen?" Die zweite ist von nicht minder praktischer Bedeutung: "Wie schaffe ich es, Menschen so zu verändern, dass sie das tun, was ich von ihnen will? Und wie schaffe ich es, mich selbst zu ändern?"
Hat man es also mit einem Ratgeber zu tun? Die Aussicht auf Antworten wirkt jedenfalls vielversprechend. Und man erwartet natürlich, dass uns die Hirnforschung zu ihnen führen soll. Doch wenn auch gleich darauf die Basis eines neurobiologischen Menschenbilds ins Spiel gebracht wird: Es sind in erster Instanz Befunde aus verschiedenen Bereichen der Psychologie, die Roth heranzieht. Am Leitfaden seiner beiden Fragen macht er sich zu einem Parcours auf, der von Ergebnissen der Persönlichkeitsforschung und Entwicklungspsychologie bis zur psychologischen Untersuchung von Entscheidungsprozessen, zu Motivations- und Lernpsychologie führt.
Da meint man, an ein methodisches Grundproblem der Hirnforschung zu rühren: Woher die Kriterien nehmen, nach denen sich entscheiden ließe, was die Laborbefunde im Einzelnen bedeuten? Werden solche Kriterien - in Ermangelung einer genuin neurobiologischen Bedeutungslehre - womöglich einfach der Psychologie entlehnt? Sind manche der "neuen" Ergebnisse der Hirnforschung in Wirklichkeit nur aufgemöbelte alte Hüte der Psychologie? Wir hören etwa Folgendes: Die Hirnforschung habe herausgefunden, dass man leichter lerne, wenn man beim Lernen gute statt schlechte Gefühle habe. Aber war uns solches nicht schon längst aus der Lernpsychologie bekannt?
Roth sieht das naturgemäß anders. Er legt nahe, die Hirnforschung sei methodisch eigenständig. So habe die moderne Hirnforschung in den letzten Jahren Methoden entwickelt, mit denen sich die empirischen Aussagen der Psychologen "fundieren" lassen. Hirnforschung fundiert demnach die Psychologie und verdoppelt sie nicht etwa. Deshalb ist es für Roth nur folgerichtig, dass die Kapitel, in denen die Modelle und Versuchsreihen der Psychologen vorgestellt werden, sich mit anderen abwechseln, die sich den neurobiologischen Grundlagen widmen. In jedem Fall gilt: Doppelt hält besser.
Tatsächlich haben Psychologen einigen Scharfsinn darauf verwendet, ein plausibles, mit unseren Alltagsintuitionen übereinstimmendes und gleichzeitig empirisch handhabbares Modell von Persönlichkeitsprofilen zu entwickeln. Von einer Skizze dieses meist verwendeten Fünf-Faktoren-Modells nimmt Roth seinen Ausgang, um der Frage nachzugehen, welche Determinanten die Herausbildung von derart charakterisierten Profilen bestimmen: warum also etwa manche von uns emotional stabiler sind als andere oder offener als eher introvertierte Mitmenschen.
Vier große Determinanten werden umrissen: genetische Ausstattung, Eigenheiten insbesondere der vorgeburtlichen und frühen nachgeburtlichen Hirnentwicklung, frühkindliche Bindungserfahrungen und schließlich die bis ins spätere Jugendalter hineinreichenden Sozialisationserfahrungen. Wie man sich das Zusammenwirken dieser Faktoren genau vorstellen sollte, welches die wirklich prägenden Phasen sind, darüber gehen allerdings die wissenschaftlichen Meinungen doch auseinander. In Roths Darstellung werden diese Spielräume auch gar nicht unter den Tisch gekehrt. Der Autor neigt eher zur Zusammenschau von Befunden, selbst wenn das Bild dadurch an Konturenschärfe einbüßt. So sympathisch, da nicht rechthaberisch ein solcher Gestus ist, so problematisch ist er auch. Steht man doch oft vor einem beziehungslosen Nebeneinander der Befunde - ein Umstand, der das Vertrauen in die methodische Solidität des Ganzen nicht eben stärkt.
Bei Roth stehen jene Faktoren im Vordergrund, die für die nachweisbaren Grenzen möglicher Formbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen stehen. Diese Grenzen sind es, die er naiven Vorstellungen von menschlicher Erziehbarkeit entgegenhält. Allerdings reichen die Einsichten in Entwicklung und Funktionsweisen des Gehirns kaum bis zu den konkreten Empfehlungen, die Roth mit Blick auf seine beiden großen Fragen offeriert. Sie formulieren eher recht allgemeine Randbedingungen, die für die Realisierung unserer mentalen Fähigkeiten von Bedeutung sind.
Man erfährt zum Beispiel manches über die neurologischen Mechanismen, die mit Entscheidungsprozessen einhergehen: Wie eng emotionale - Stichwort limbisches System - und kognitive Bewertungen verknüpft sind, welche Anteile unbewusst prozessiert werden, in welchen spezifischen Arealen und mit welcher Aussicht, zu bewusster Wahrnehmung gebracht zu werden. Damit lassen sich zwar einige falsche Vorstellungen aus dem Weg räumen, aber offensichtlich keine handfesten Maximen für optimierte Entscheidungsstrategien hervorzaubern. Weil auch die einschlägigen psychologischen Experimente viel Spielraum lassen, kann dann zum Schluss etwa stehen: "Lassen wir also, der Ermahnung kluger Menschen folgend, bei Entscheidungen den Verstand walten."Fürwahr kein schlechter Rat. Auch wenn die Regeln etwas konkreter werden, bleiben sie auf dem Feld dessen, was man einschlägig erfahrenen Leuten an Einsicht zutraut.
Bleibt noch das Gehirn. Die Gehirnentwicklung firmiert bei Roth als determinierender Faktor der Herausbildung von Persönlichkeitsprofilen. Das meint die einsichtige Behauptung, dass genetischen Ausgangspositionen, Entwicklungshemmungen, Läsionen oder Erkrankungen des Gehirns eine ursächliche Rolle für die Ausübung mentaler Fähigkeiten zugesprochen werden kann. Aber mit einem gleitenden Übergang vom pathologischen zum normalen Fall landet man bei der merkwürdigen Vorstellung, dass konkrete Eigenschaften des Gehirns auch dann ursächlich zu verstehen sind, wenn es um diese normalen Fähigkeiten geht.
Bei Roth oszilliert der Sinn manchmal zwischen den beiden Varianten. Woran man sieht, dass das Gehirn bei ihm seine metaphysischen Mucken nicht ganz abgestreift hat. Immer noch versucht es da und dort, das letzte Wort zu behalten, und entpuppt sich dabei als eine Art eigenständiger Akteur. Aber entscheiden müssen halt trotzdem wir selbst.
HELMUT MAYER.
Gerhard Roth: "Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten". Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2007. 349 S., geb., 24,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
In Christiane Pries' Besprechung dieses Buchs des Hirnforscher Gerhard Roth muss sich der Leser ganz schön durch neurowissenschaftliches Fachvokabular ackern, doch hängen bleibt, dass Pries ein aufschlussreiches und mit anschaulichen Beispielen aus der experimentellen Psychologie versehenes Buch gelesen hat, das die wesentlichen Forschungsergebnisse allgemein verständlich zusammenfasse. Doch ein uneingeschränkt positives Urteil möchte Pries nicht abgeben. Genauso wie Intelligenz und andere Gehirnaktivitäten, bilden sich die Muster für Persönlichkeit, Entscheidungsfindung und Verhalten bereits im Mutterleib, sie sind genetisch festgelegt oder entwickeln sich in verschiedenen Bereichen des Gehirns während der ersten Lebensmonate. Von dieser Grundannahme ausgehend, sei es nicht unmöglich, in fortgeschrittenem Alter Verhalten oder gar Persönlichkeit zu ändern, es werde nur wesentlich schwieriger, fasst Pries Roths Ergebnis zusammen. Ein großes Ärgernis ist für sie, dass sich der als Kritiker der Willensfreiheit bekannte Roth um eine eindeutige Stellungnahme zum Thema drückt und völlig offen lässt, inwiefern hier von Annahmen oder Tatsachen ausgegangen wird. Schließlich findet die Rezensentin bedauerlich, dass sich das Buch dem Duktus der "Ratgeberliteratur für höhere Führungskräfte" andiene und recht altbacken empfehle, im Zweifel auf die Ehefrau zu hören.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH