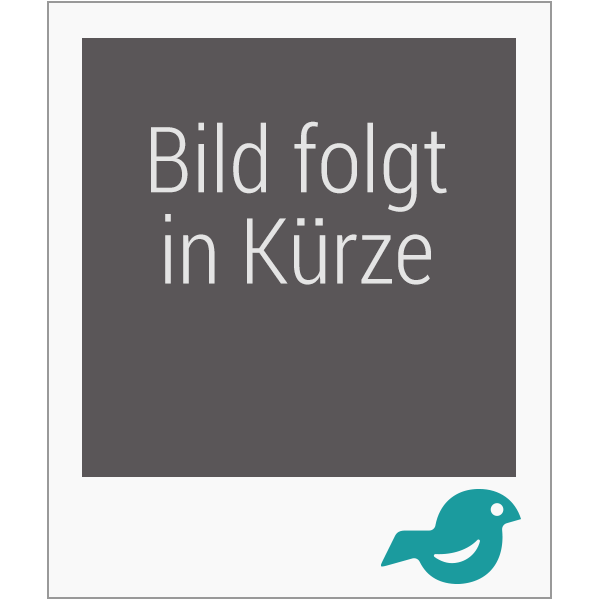Unter den deutschen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts war Herbert Reinecker (1914-2007) einer der einflussreichsten - vor allem dank des ZDF. Doch seine breit gefächerte Präsenz in bundesdeutschen Medien ging nicht allein zurück auf die erfolgreichen Kriminalserien "Der Kommissar" und "Derrick", sondern begann bereits in der frühen Bundesrepublik mit Kurzgeschichten und Hörspielen, die aus einer restaurativen Sicht auf den deutschen Alltag blickten. Zum Starautor wurde Reinecker anschließend mit Drehbüchern zu anspruchsvoll unterhaltenden Kinofilmen, darunter "Canaris" und "Der Stern von Afrika". Dabei handelt es sich um weitgehend distanzlose Annäherungen an die unmittelbar vergangene Epoche, deren Selbstverständnis als "Antikriegsfilme" bereits auf zeitgenössischen Widerspruch stieß. Die professionellen Ursprünge von Reineckers Schaffen liegen in den 1930er und 1940er Jahren, als er bis 1939 zunächst für Propagandaschriften der Reichsjugendführung verantwortlich war und sodann als Kriegsberichter der Waffen-SS Zeitungen mit Feuilletons von der Front belieferte. Mit zunehmender Kriegsdauer und abnehmendem Kriegsglück Setzte er darin seine fanatische Hoffnung auf die Leistungen einer künftigen deutschen Hitlerjugend. Dass er zudem als Protegé des "Reichsdramaturgen" Rainer Schlösser als kommender Dramatiker des NS-Theaters galt, ist wenig bekannt. Seine vier Dramen sind Apologien des Systems und des Krieges.
Alle Werkaspekte Reineckers werden von den Autoren gewürdigt. Dabei wird eine besondere Aufmerksamkeit den bislang unerschlossenen Texten aus der Zeit vor 1945 und den ersten Nachkriegsjahren gewidmet. So erst gerät das Gesamtwerk in den Blick, werden innere Bezüge sowie Verarbeitungsmuster von teils selbst erlebter Zeitgeschichte und biografischen Fragmenten in fiktiven Erzählformen erkennbar.
Alle Werkaspekte Reineckers werden von den Autoren gewürdigt. Dabei wird eine besondere Aufmerksamkeit den bislang unerschlossenen Texten aus der Zeit vor 1945 und den ersten Nachkriegsjahren gewidmet. So erst gerät das Gesamtwerk in den Blick, werden innere Bezüge sowie Verarbeitungsmuster von teils selbst erlebter Zeitgeschichte und biografischen Fragmenten in fiktiven Erzählformen erkennbar.

Der Deutschen liebster Drehbuchautor: Herbert Reinecker
Wäre Herbert Reinecker im Frühjahr 1945 nicht aus Berlin geflohen, sondern der Roten Armee in die Hände gefallen oder auf der Flucht nach Österreich einem misstrauischen Posten der Feldpolizei begegnet, hätte dieses Buch nicht geschrieben werden müssen. Reinecker würde dann in der deutschen Filmgeschichte lediglich als Autor des Jugendfilms "Junge Adler", den sein Freund Alfred Weidenmann 1944 in Szene setzte, auftauchen.
Einer Pressegeschichte der NS-Zeit wäre er als Schriftleiter verschiedener Zeitschriften der Hitlerjugend und als gelegentlicher Mitarbeiter des "Völkischen Beobachters" und der SS-Zeitschrift "Das Schwarze Korps" erwähnenswert, einer Theatergeschichte jener dunklen Epoche als Verfasser des propagandistischen Bühnenstücks "Das Dorf bei Odessa", das 1942 das Vorrücken der Wehrmacht als Befreiungstat feierte. Für das Drehbuch zu "Canaris" hätte sich wiederum Weidenmann 1954 einen anderen Autor suchen müssen und dann vielleicht keinen Bundesfilmpreis errungen. Und wie erst hätte das ZDF ohne die Dauerbrenner "Der Kommissar" (93 Folgen) und "Derrick" (281 Folgen) dagestanden? Aber Reinecker, 1914 im westfälischen Hagen als Sohn eines Eisenbahnschaffners geboren, ist 92 Jahre alt geworden und hat sein ganzes Leben mit Schreiben zugebracht - für drei Autoren Stoff genug.
"Reineckerland" haben Rolf Aurich, Niels Beckenbach und Wolfgang Jacobsen ihre flüssig geschriebene Studie, mehr Essay als wissenschaftliche Abhandlung, über einen entschiedenen Parteigänger des NS-Systems genannt, der sich von seinen frühen Gesinnungsschriften zwar nie expressis verbis distanzierte, wohl aber bereits in den ersten Nachkriegsjahren als Feuilleton-Autor ein anderer zu werden versprach. Das Wortspiel mit dem Familiennamen suggeriert indes verallgemeinernd eher eine typische Kontinuität als Bruch und Neuanfang. Aber hätte das ausdrückliche Eingeständnis, als Zwanzigjähriger der ideologischen Verführungskraft einer Diktatur erlegen zu sein und die jugendliche Begeisterungsfähigkeit für einen schlechten Zweck verschwendet zu haben, Reinecker in den Augen seiner Richter freisprechen können? Als Frontberichterstatter habe er 1944 die jungen Soldaten der SS-Panzerdivision "Hitlerjugend" während der Ardennen-Offensive förmlich in den Tod gehetzt, lasten ihm die Autoren insbesondere an und meinen, bei ihm dafür am Ende seines Lebens "ein Entsetzen über sich selbst" und das Gefühl der "eigenen Verdammnis" erkennen zu können.
Der so dem Fegefeuer Überantwortete (dessen evangelische Konfession diesen Begriff indes nicht kennt) habe jedoch, so erklärt der Literaturwissenschaftler und Reinecker-Freund Lutz Götze in einer E-mail an die Autoren, nach dem Krieg "mit seinen Büchern Menschen von ihren mörderischen Trieben zu heilen" versucht. Noch bevor die Kommissare in jeder Folge dem Guten zum Sieg verhalfen, entwarf Reinecker eine Filmstory, die für ihn aufschlussreich war, deren Realisierung aber zum Glück unterblieb. "Der Arzt und das Ungeheuer" sollte seinen einstigen obersten Dienstherrn Heinrich Himmler - Reinecker war 1940 Mitglied der SS geworden - und dessen Leibarzt und Masseur Felix Kersten im Disput um die Menschlichkeit zeigen, bei dem Kersten den moralischen Endsieg davontrug, nicht ohne die "Auferstehung" Deutschlands im Sinn einer wertkonservativen Erneuerung vorherzusagen. Dafür schickte dann später Reinecker seine Kommissare an die Gegenwartsfront des Fernsehens, wo deren Nachfolger noch immer Woche für Woche ihren Mann stehen.
Man mag dieses Konzept für beschränkt halten, da es die Verhältnisse nimmt, wie sie sind. Eine Denkkontinuität des "Vielschreibers" von den dreißiger Jahren, wo er den Krieg geradezu herbeischrieb, bis in die Neunziger nachzuweisen bleibt der uneingelöste Vorsatz der Autoren, sooft sie in ihren um Reineckers Leben und Werk elliptisch kreisenden Indiziennachweisen auch die unbestreitbare Gewissensschwäche des Mannes beschwören. Und doch erschließt dieses zuverlässig editierte Buch mit seinem dichtverzweigten Quellenwerk sowie den erschöpfenden biblio- und filmographischen Auskünften eine exemplarische Lebensgeschichte, die womöglich selbst Stoff eines Spielfilms hätte werden können.
HANS-JÖRG ROTHER
"Reineckerland."
Hrsg. von Rolf Aurich, Niels Beckenbach und Wolfgang Jacobsen. Edition text + kritik, München 2010. 336 Seiten, zahlr. Abb., 29,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main