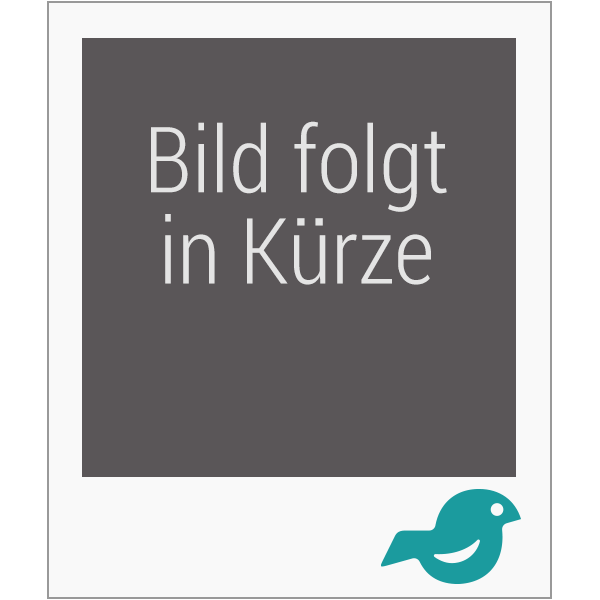Produktdetails
- Verlag: Suhrkamp
- ISBN-13: 9783518410806
- ISBN-10: 3518410806
- Artikelnr.: 23932259
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Morgen wird alles besser: Eine lebensluge Geschichte von Vita Andersen · Von Christoph Bartmann
Es ist nicht leicht, ein Künstlerkind zu sein. Vor allem dann nicht, wenn die Künstlermutter und auch schon die Künstlergroßmutter alle zur Verfügung stehende Extravaganz und Exaltiertheit für sich reserviert haben. Die Eltern leben ihr vie de bohème, und das Kind sehnt sich nach ein bisschen bürgerlicher Verlässlichkeit. Vita Andersen erzählt in ihrem Roman "Sebastians Liebe", der 1992 in Kopenhagen erschienen ist, aus einem dänischen Familienleben, das man typisch finden kann, ohne dass die Autorin auf Typisierung hinaus will. Sebastians Eltern kann man wohl "Achtundsechziger" nennen. Diese Eltern, die Malerin Carla und der schriftstellernde Werbetexter Felix, sind durchaus sympathische, wenn auch etwas konfuse und reichlich selbstbezogene Vertreter einer Generation, die, verständlich genug, vom Leben mehr Spaß und weniger Verantwortung erwartet als die vorangegangene.
Im Mittelpunkt des Romans stehen Carla und ihr Sohn Sebastian. Felix, Sebastians Vater, hat in der Zwischenzeit mit einer neuen Frau eine neue Familie gegründet. Von ihm wird erst die Rede sein, als Sebastian frustriert und verwirrt aus Spanien heimkehrt, wo seine Mutter mit ihrem nächsten Freund, einem Fotografen, ein neues Leben beginnen will. In Kopenhagen, so sieht es zumindest im ersten Teil des Romans aus, war zwischen Mutter und Sohn die Welt noch in Ordnung gewesen. So weit in Ordnung, muss man ergänzen, wie die Welt zwischen Carla und Sebastian überhaupt in Ordnung sein kann. Denn Carla, die Mutter, ist ein ständig in artistischer Hochspannung befindliches Aktions- und Nervenbündel.
Das Leben mit ihr kann für jeden Mitmenschen, und erst recht für den Sohn, ein Wechselbad von Qual und Entzücken werden. "Um sich herum", heißt es von Carla, "verbreite sie Geräusch und Bewegung. Sie tanzte und spielte vor der Staffelei . . . Jetzt lag ihre Stirn in Falten, und ihre Augen waren kleine chinesische Schlitze. Dann ein tiefer Zug an der Zigarette, als sähe sie das Bild durch den Rauch anders. Sie nahm eine neue Zigarette und zündete sie an der alten an." Es ist ein Zug von Hektik und, bei allem Charme, von zerrütteter und zerrüttender "Kreativität" um diese Frau, der das abweichende Verhalten des Sohnes plausibel macht. Der Wasserschaden, den zu Beginn des Romans eine überlaufende Badewanne verursacht, steht unauffällig sinnbildlich für den Umstand, dass für den herrschenden Dauer-Überschwang nicht genug Gefäße bereitstehen.
Diese Mutter, auch wenn sie ein Höchstmaß an Zärtlichkeit und Zuwendung aufbringt, braucht alle Luft und allen Raum für sich allein . Sie braucht ihn wahrscheinlich auch deshalb für sich, weil ihr die eigene Mutter ebenfalls die Luft nahm. Samsara, so ihr ausgefallener Name, ist Tänzerin gewesen, und sie hat ihrer Tochter das Gleiche zugemutet, was Carla ihrem Sohn Sebastian zumutet: "Überall Chaos", wie Carla sich erinnert. Und zwischendrin, gelegentlich, ein paar Männer, als Liebhaber und Statisten.
Aus Spanien ist Sebastian allein nach Kopenhagen zurückgekehrt. Er wohnt nun als Gast in der Familie seines Vaters, mit dessen neuer Frau und den hinzugekommenen Halbschwestern. "Sie betrachteten ihn", heißt es von den Schwestern, "mit abschätzendem, in die Zukunft gerichtetem Blick. Ihre Augen waren schmal und schimmerten böse, als hätten sie zuviel gesehen." Sebastian antwortet darauf, indem er seinen "bösen Blick" gebraucht. Langsam, aber stetig gerät er auf die schiefe Bahn. Er meldet sich auf gestohlenem Briefpapier selbstständig aus der Schule ab. Er zieht in eine Mansarde und fängt an, mit ein paar Kumpanen Klebstoff zu schnüffeln. Er betätigt sich als Pflastermaler und nimmt ein gleichaltriges Mädchen von der Straße, halb Entführer, halb Beschützer, bei sich auf.
Am Ende des Romans sehnt sich Sebastian nur noch nach dem gewöhnlichen Leben, nach der Schule, nach Eltern und einem Zuhause. "Er dachte daran", heißt es zum Schluss, "wie die Erde eingerichtet war . . . Er dachte an die Zusammensetzung des Universums, die Sonne, den Mond und die Sterne. Heute ist besser als morgen, und morgen wird besser sein als heute."
Vita Andersen, die sich schon in früheren Büchern als hellsichtige Beobachterin kindlicher Gefühlslagen erwiesen hat, erzählt von Carla und Sebastian, als kenne sie diese Figuren aus nächster Nähe. Nie denkt man dran, sie hätte sich die Personen ausgedacht und sie nach und nach mit Eigenschaften ausgestattet. Alles sieht so aus, als habe sie diese im Leben vorgefunden. Mit ihren erzählerischen Mitteln verhilft ihnen Vita Andersen zu einem Leben in der Literatur. Sie schafft es, die Ursachen und Umstände von Sebastians Verstörung ganz und gar plausibel zu machen, ohne dass sie auf psychologische Modelle und Verallgemeinerungen zurückgreifen müsste. Alles wird nachvollziehbar in diesem Roman: aus Vita Andersens lebenskluger, manchmal vielleicht ein wenig mütterlicher, und nie verallgemeinernder Beobachtung von Individuen in bestimmten Lebenslagen. Von jugendlichen Individuen. Vielleicht hat Vita Andersen ja ein Buch für Heranwachsende geschrieben. Dann aber ist es ein glänzendes.
Vita Andersen: "Sebastians Liebe". Roman. Aus dem Dänischen übersetzt von Peter Urban-Halle. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1999. 286 S., geb., 39,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main