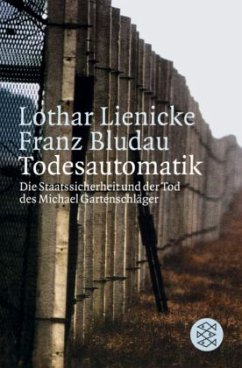Michael Gartenschläger wurde nur 32 Jahre alt. Fast zehn Jahre davon verbrachte er in Gefängnissen der DDR. Er wurde mit 17 zu lebenslanger Haft verurteilt, da er gegen den Bau der Mauer demonstrierte. 1971 wird er von der Bundesregierung "freigekauft". Doch das real existierende Unrecht hinter dem Eisernen Vorhang lässt ihn nicht los: Er wird Fluchthelfer. Sein spektakulärster Coup ist die Demontage von zwei Selbstschussgeräten im Grenzgebiet, deren Existenz der SED-Saat bisher geleugnet hatte. Damit wird er erneut zum "Staatsfeind". Bei einem weiteren Demontageversuch wird Gartenschläger 1976 von einem Stasi-Kommando erschossen. Der Prozess gegen die Schützen dauert noch an.

Michael Gartenschlägers Kampf gegen das real existierende Unrecht
Lothar Lienicke/Franz Bludau: Todesautomatik. Die Staatssicherheit und der Tod des Michael Gartenschläger an der Grenzsäule 231. Vertrieb durch Stampmedia GmbH, Hamburg 2001. 456 Seiten, 25,50 Euro.
Michael Gartenschläger wurde nur 32 Jahre alt. Fast zehn Jahre seines kurzen Lebens verbrachte er in Gefängnissen und Zuchthäusern der DDR. Wenn ihm nun eine politische Biographie gewidmet wird, dann ist das schon ein ungewöhnlicher Versuch. Er ist aber gelungen. Dem Zeitzeugen der Ereignisse vor über 25 Jahren bietet das sorgfältig recherchierte Buch Erinnerungen und manches neue Detail. Dem jüngeren, zeitgeschichtlich interessierten Leser kann er den Zugang zu einer aufregenden und in ihrer Komplexität oft verwirrenden Phase der Deutschland-Politik nach dem Kriege erleichtern.
Im Jahre 1961 war Gartenschläger ein Schlosserlehrling in Strausberg bei Berlin, der am 13. August durch die Sperrmaßnahmen der DDR mit seinen Freunden von den Freizeitvergnügungen und Informationsmöglichkeiten im nahen West-Berlin abgeschnitten wurde. Die jungen Leute wollten spontan Widerstand leisten, malten antikommunistische Parolen an Wände und ließen sich leider auch zur Brandstiftung an einer alten Scheune hinreißen. Das Regime reagierte auf diese jugendliche Torheit mit brutaler Härte. In einem Schauprozeß, bei dem das Urteil von vornherein feststand, wurde der noch minderjährige Gartenschläger, ebenso wie ein Freund, zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, wovon er neun Jahre und zehn Monate verbüßen mußte, bis ihn die Bundesrepublik endlich freikaufen konnte.
Diese unmenschliche Strafe hat Gartenschläger nicht gebrochen, aber sicherlich entscheidend dazu beigetragen, daß seine Abneigung gegen das DDR-Regime in blanken Haß umschlug. Er wollte etwas gegen das real existierende Unrecht tun. Zusammen mit seinem Freund Lienicke, dem Mitautor des jetzt vorliegenden Buches, verhalf er innerhalb von drei Jahren 31 Personen zur Flucht aus der DDR. Dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) blieb das natürlich nicht verborgen. Berühmt wurde Gartenschläger jedoch erst, als er 1976 innerhalb weniger Wochen mit Glück und technischem Geschick zweimal an der Zonengrenze installierte Selbstschußgeräte der DDR abbaute und diese mörderischen Waffen, die gegen die eigene Bevölkerung gerichtet waren und die Wirkung von Dumdumgeschossen hatten, der Öffentlichkeit präsentierte. Bei einem dritten Versuch in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai geriet Gartenschläger in einen vom MfS gelegten Hinterhalt und wurde von vier "Kämpfern" kaltblütig erschossen.
Die letzten hundert Seiten des spannend geschriebenen Buches behandeln die Ereignisse nach Gartenschlägers Tod und vor allem nach der Wende, als einigen der Täter im wiedervereinigten Deutschland der Prozeß gemacht wurde. Er endete mit Freisprüchen, da den Schützen nicht widerlegt werden konnte, daß sie zumindest in Putativnotwehr gehandelt hatten. Mit diesem Urteil setzen sich die Autoren mit Sachverstand auseinander. Man muß ihnen zubilligen, daß sie gute Gründe für die Annahme haben, Gartenschläger habe von vornherein "liquidiert" werden sollen, sein Tod sei von der Führung des MfS, wenn nicht sogar beabsichtigt, so doch billigend in Kauf genommen worden. Der irdischen Gerechtigkeit dient dies Ergebnis nicht mehr. Es wird aber wenigstens das Urteil der Geschichte zugunsten des Opfers beeinflussen.
Zu den Vorzügen des Buches gehört, daß es das Leben Gartenschlägers in die Ereignisse der "großen Politik" einordnet. Dabei werden die Schlachten der siebziger Jahre um Sinn oder Unsinn der Ostpolitik der SPD-FDP-Koalition noch einmal geschlagen. Selbst wer, wie der Rezensent, den Autoren dabei in ihrer kritischen Einstellung nicht folgen mag, muß zugeben, daß Gartenschläger Grund hatte, mit der Zurückhaltung der westlichen Gesellschaft gegenüber dem offenkundigen Unrecht in der unmittelbaren Nachbarschaft unzufrieden zu sein. Er wollte die Öffentlichkeit aufrütteln, und das ist ihm zeitweise auch gelungen. Allerdings mußte er dafür mit seinem Leben bezahlen. Die Todesautomaten "sicherten" noch acht Jahre lang die DDR-Staatsgrenze gegen Fluchtversuche der eigenen Bevölkerung. Dann wurden sie abgebaut, weil Honecker in Vorbereitung seines Staatsbesuchs in Bonn und als Gegenleistung für den von Strauß "eingefädelten" Milliardenkredit etwas für das Image der DDR tun wollte.
Der gediegen ausgestattete Band endet mit Dokumenten, die Einblicke in die Arbeitsweise des MfS, aber auch der westdeutschen Justiz bieten - etwa wenn letztere es für möglich hält, Gartenschläger könnte durch den Abbau eines Todesautomaten gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Die Namen hoher MfS-Offiziere, die schon aufgrund ihrer Stellung Personen der Zeitgeschichte sein dürften, werden nur abgekürzt wiedergegeben. Allerdings kann man die meisten von ihnen anhand einschlägiger Veröffentlichungen unschwer identifizieren.
DETLEF KÜHN
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main