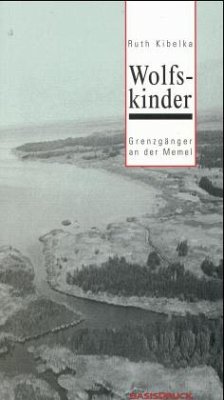Im vorliegenden Band zeichnet Ruth Kibelka das Schicksal ostpreußischer Kinder auf, die während der sowjetischen Besetzung zu Waisen wurden. Nicht nur die Archive Kaliningrads und Litauens werden hier erstmals ausgewertet - auch viele Überlebende sprechen zum ersten Mal seit 1944 über ihre Geschichte.

Das Schicksal deutscher Waisen im besetzten Ostpreußen
Ruth Kibelka: Wolfskinder. Grenzgänger an der Memel. BasisDruck Verlag, Berlin 1996. 239 Seiten, Paperback, 24,80 Mark.
Wolfskinder? Das Wort wird den wenigsten etwas sagen. Kaum einer wird Eberhard Fechners Fernsehfilm von 1991 über das Thema noch in Erinnerung haben. Zu Wolfskindern wurden nach 1945 Tausende elternlos gewordener, allein übriggebliebener ostpreußischer Jungen und Mädchen. "Wir hungerten. Die Großmutter starb, dann die Tante, die erst 18 war. Dann starb Mama. Es blieben nur die Schwester und ich." - "Ich war 13 Jahre, als die Mutter starb, und hatte die kleinen Geschwister. Und sie hat gesagt: ,Ruth, du bist die Älteste, verlaß die kleinen Geschwister nicht.' Der kleinste Bruder war drei Jahre alt. Der war ausgehungert, den habe ich immer geschleppt, und dann bin ich betteln gefahren . . ."
Nachdem ab September 1945 die neue Grenze zu Polen mit Stacheldrahtzäunen und Todesstreifen hermetisch abgeriegelt worden war, hatten deutsche Kinder nur dann eine Überlebenschance, wenn es ihnen gelang, irgendwie nach Norden zu entkommen, um dort Eßbares zu erbetteln, auch einen Unterschlupf. Denn man überlebt als Kind nicht lange einsam in den Wäldern. Diese Waisen, die man in Litauen vokietukai, kleine Deutsche, nannte, kamen vielfach mit dem Zug in die ihnen bis dahin unbekannte Nachbarregion. Personenzüge waren selten, außerdem hatten die meisten kein Geld für Fahrkarten. So versuchten sie es mit Güterzügen, bei jedem Wetter, auch bei strömendem Regen und schneidender Kälte, in offenen Waggons, auf Puffern, in Bremserhäuschen. Wurden die Kinder erwischt, gab es Schläge, ja sie riskierten, rücksichtslos aus den Waggons oder von den Dächern und Puffern der Güterzüge gestoßen zu werden, ungeachtet aller Folgen. Andere versuchten, auf Brettern über die Memel zu setzen. "Was denkst du, wie viele Kinder da reingefallen sind. Das Brett fiel um - das Kind war weg."
In jenen Zeiten wurden Kinder schnell zur Handelsware. Auf den litauischen Bauernhöfen wurde jede Hand gebraucht. Außerdem suchte, wer keinen eigenen Nachwuchs hatte, mit der Aufzucht dieser fremden Kinder für sein Alter vorzusorgen. "Ich ging von einem Bauern zum nächsten. Irgendwo unweit von Mariampole traf ich eines Tages Leute, die mich für einen halben Liter Schnaps kauften und mitnahmen." Natürlich mochte man keine unnützen Esser. In der Regel durfte nur das eine Kind, für das man Arbeit hatte, auf dem Hof leben, nicht seine Geschwister. Sie wurden manchmal bei Verwandten der Bauern in Nachbardörfern untergebracht. Andernfalls mußten sie selbst weitersuchen. Häufig verläuft sich die Spur eines Kindes, wenn es fortlief, weil es die Behandlung nicht mehr ertrug oder ihm das Arbeitspensum zu schwer wurde. So kam es oft vor, daß sich Geschwister verloren, die sich anfangs noch regelmäßig sonntags getroffen hatten. Wer ein kleines, unselbständiges, vielleicht sogar krankes Geschwisterkind auf den Hof mitbringen durfte, konnte sich glücklich schätzen. Aber natürlich bedeutete das doppelte Arbeit. Das Kind mußte versorgt und sein Essen verdient werden.
Viele Wolfskinder sind, oft erst Jahrzehnte später, in den Westen, zu deutschen Verwandten, ausgereist. Andere sind in Litauen geblieben und Litauer geworden. Manche, die ganz, ganz jung in die Fremde gerieten, wissen nicht einmal mehr, daß ihre Eltern - und damit sie selbst einst - Deutsche waren. So kann man in einem litauischen Aktenvermerk aus dem Jahre 1951 lesen: "Auf ihre Anfrage über den Zögling des Wilnaer Kinderheims Nr. 3, Arno Wilhelmowitsch M., teile ich mit, daß M. in einem persönlichen Gespräch erklärt hat, daß er von seinen Eltern nichts weiß und sich an nichts erinnert. Genauso hat er keine Erinnerungen an Geschwister und weiß nicht einmal, ob er welche hatte . . ."
Ruth Kibelka, die in DDR-Bürgerrechtsgruppen aktiv war und bis 1989 als Übersetzerin für Litauisch und Polnisch arbeitete, weil sie damals nicht studieren durfte, ist in vielen, vielen Interviews vor Ort dem Schicksal ostpreußischer Kinder nachgegangen, die am Kriegsende und danach zu Waisen wurden. Sie hat darüber hinaus, inzwischen professionelle Historikerin geworden, erstmals Archive in Kaliningrad und Litauen ausgewertet. Daher enthält ihre Pionierstudie viele Informationen, die das Schicksal der Wolfskinder in die größeren Zusammenhänge jener düsteren Zeiten einbetten.
So bestätigt sie, daß die Eroberung Ostpreußens besonders schrecklich war. Mord, Raub und Plünderungen, Vergewaltigungen und Verschleppungen waren an der Tagesordnung. Die sowjetische Armeeführung hatte in Flugblättern zu Härte und Grausamkeit gegen die Deutschen aufgefordert. Zumal Königsberg sollte als Nest des deutschen Militarismus vernichtet werden. "Ostpreußen war das personifizierte Feindbild, ein Land, das absichtlich und mutwillig zerstört werden mußte, um am Feind Rache zu üben."
Dieser Vernichtungsimpuls könnte erklären, weshalb Moskau zunächst zögerte, das verwüstete Gebiet zu annektieren. 1944 scheint Stalin einige Zeit lang erwogen zu haben, das nördliche Ostpreußen mit Litauen zu vereinigen. Auch als klar war, daß das Königsberger Gebiet an die Sowjetunion fallen werde, scheint der sowjetischen Militär-Administration in Deutschland ein Befehl vorgelegen zu haben, ostpreußische Flüchtlinge als Arbeitskräfte in ihre Heimat zurückzuschicken, da man zu jener Zeit nicht daran interessiert war, ein menschenleeres Gebiet zu übernehmen. Bis zum heutigen Tage, schreibt Frau Kibelka, sei nicht wirklich erklärlich, aus welchen Gründen die sowjetische Regierung auch nach der Potsdamer Konferenz, auf der ihr das nördliche Ostpreußen zugesprochen wurde, fast ein Jahr lang zögerte, dieses Gebiet in die UdSSR einzugliedern. Erst im Juli 1946 wurde Russisch Ostpreußen als Kaliningrader Oblast an die RSFSR angeschlossen. Für unsere in Ostpreußen verbliebenen oder dahin zurückgekehrten Landsleute hat es jedenfalls nie mehr ein Ende ihrer Stunde Null gegeben. Ein ganzes Kapitel widmet Frau Kibelka dem Hunger, der besonders schlimm im Winter 1946/47 wurde, als es überhaupt nichts mehr zu essen gab. Selbst Ratten waren begehrt, und es kam zu Fällen von Kannibalismus, von dem sogar eigene Familienmitglieder nicht verschont blieben.
In einem anderen Kapitel ist von den wiederholten Massen-Deportationen litauischer Bauern die Rede. Zumeist umstellten Bewaffnete nachts die Gehöfte und teilten den Familien mit, daß sie verbannt würden. Mit eilig zusammengerafftem Gepäck wurden sie unter strenger Bewachung zum nächsten Bahnhof gebracht, für den Fall der Flucht mit sofortiger Erschießung bedroht. Von Soldaten in Viehwaggons gestoßen und hinter vernagelten Türen überlegten die Insassen, wo man sie wohl umbringen werde. Die Züge standen oft noch mehrere Tage in Bahnhofsnähe, bis die Fracht vollzählig war. Am Ende mehrwöchiger Irrfahrten landete man meist in Westsibirien oder Kasachstan.
Litauer erhoben sich gegen ihre grausame Unterdrückung. Viele Männer und Frauen, in der Bevölkerung "Waldleute" genannt, leisteten dem Sowjetregime über Jahre hinweg bewaffneten Widerstand, der erst 1952 endgültig gebrochen werden konnte. In Südlitauen versuchten diese Waldleute sogar, Kontakte zum Kaliningrader Gebiet anzuknüpfen, um auch die Menschen dort zur Auflehnung gegen die Russen zu ermutigen, was aber mißlang. "Die Litauer schätzten die Lage falsch ein. Für sie war es ein Jahr nach Kriegsende völlig undenkbar, daß die Deutschen das Territorium jemals verlassen würden. Doch die Perspektive der ostpreußischen Bevölkerung hieß damals schon Ausreise und bei weitem nicht aktiver Widerstand." ARNULF BARING
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main