BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 194 Bewertungen| Bewertung vom 10.01.2026 | ||
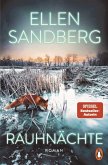
|
Vorab: “Rauhnächte” von Ellen Sandberg erschien in anderer Form unter dem Klarnamen der Autorin, Inge Löhnig, bereits vor über zehn Jahren als Jugendroman. Die Geschichte forderte laut Nachwort “neue Perspektiven, verlangte mehr Tiefe, mehr Dunkelheit und mehr Reife.” (S. 344) Ich persönlich kannte sie noch nicht, da dies mein erstes Buch der Autorin ist. |
|
| Bewertung vom 28.12.2025 | ||
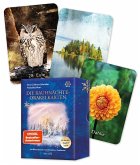
|
Ich hätte ja niemals gedacht dass ich das mal sagen würde, aber 2025 war so etwas wie ein spirituelles Erweckungsjahr für mich. Es ist nicht so, dass ich jetzt plötzlich nur noch mit Batikklamotten (hab gar keine) und Räucherstäbchen (idem) aus dem Haus gehe, aber meine Gedankenwelt hat sich verändert. Die Art, wie ich mich und die Welt um mich herum wahrnehme, welche Story ich mir in meinem Inneren erzähle. |
|
| Bewertung vom 20.12.2025 | ||

|
Die wunderbaren Schafe der Amelie und der Tote im Englischen Garten (eBook, ePUB) Wer zu Weihnachten einen cosy Krimi sucht, der weich und kuschelig wie Schafwolle anmutet, perfekt für alle ist, die kein Fleisch essen und/oder sich für Tierrechte einsetzen und München als Schauplatz lieben, der ist mit “Die wunderbaren Schafe der Amelie und der Tote im Englischen Garten” an der exakt richtigen Stelle. Erst als ich das hier schreibe, geht mir ein Licht auf, an welchen französischen Feelgood-Film der doch recht lange Titel angelehnt ist. Ich habe scheinbar eine ebenso lange Leitung, aber das nur am Rande. |
|
| Bewertung vom 15.12.2025 | ||

|
Als Liebhaberin der Horowitz-Krimis im Allgemeinen und der Susan-Ryland-Reihe im Speziellen, musste ich “Mord zur Teestunde” natürlich lesen. Schließlich geht es in den Krimis darum, dass eine Lektorin in Kriminalfälle hineingezogen wird, die mit der von ihr lektorierten Krimi-Reihe rund um den Detektiv “Atticus Pünd” zusammenhängen. Aber sein Autor, Alan Conway, ist seit dem letzten Band (“Moonflower Murders”) tot. Und dennoch gibt es diesen dritten Band der Reihe - weil anscheinend die Schauspielerin, die Susan in den Verfilmungen spielt, das angeregt hat. |
|
| Bewertung vom 05.12.2025 | ||
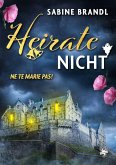
|
Ich liebe ja Burgen und Mittelalter und den ganzen Kram und queere Geschichten sowieso. Also musste ich “Heirate nicht - ne te marie pas!” von Sabine Brandl einfach lesen. Es geht darin nämlich um die lesbische Mittdreißigerin Nora, die in einer Coverband singt, seit ihrer letzten Beziehung in München wohnt, aber aus dem Fränkischen stammt. Obwohl sie sich beruflich mit Schlagern befasst, ist sie eher “gothic” drauf, also zumindest was ihre schwarze Alltagskluft und ihre private Vorliebe für “dark punk”-Musik betrifft. Ja und diese Person ist jetzt auf einer - ursprünglich - mittelalterlichen Burg, die zu einem Hotel umgebaut wurde. Warum eigentlich? |
|
| Bewertung vom 29.11.2025 | ||
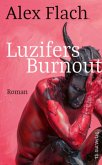
|
Der Teufel hat keine Lobby. Seine Fürsprecher wie Satanist*innen sind zurecht negativ behaftet und werden gerne mit geopferten Hühnern in Verbindung gebracht. Unappetitlich und unschön, warum also sollte man dem “Fürst der Finsternis”, wie er im Lauf der Menschheitsgeschichte gerne genannt wurde, auch nur einen positiven Gedanken entgegenbringen? Er ist schließlich das Böse in Person. |
|
| Bewertung vom 25.11.2025 | ||
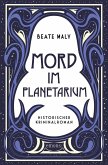
|
Vorab: “Mord im Planetarium”, erschienen im November 2025, ist eigentlich der zehnte Fall der Reihe um Anton und Ernestine, die im Wien der 1920er Jahre gemeinsam Kriminalfälle lösen. Tatsächlich ist aber im September 2025 ein Weihnachtsbuch mit den beiden erschienen: “Advent im Grandhotel”, die “Geschichte” spielt im Dezember 1926. Leider habe ich diesen Band übersehen, aber in ihm passieren einige Dinge, auf die in “Mord im Planetarium” referenziert wird. Zu meiner Verständnisproblematik, was die Chronologie der Bände betrifft, weiter unten mehr. |
|
| Bewertung vom 13.11.2025 | ||
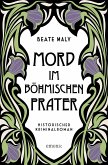
|
Kurz bevor der zehnte Fall des historischen Wiener “Ermittlerpärchens” Anton Böck und Ernestine Kirsch erschienen ist, habe ich es jetzt endlich geschafft den letztes Jahr veröffentlichten neunten Band der von mir so geliebten Reihe zu lesen: “Mord im Böhmischen Prater”. Beate Maly ist eine Schnell- und Vielschreiberin und schafft es dabei gleichzeitig bravourös, eine gleichbleibende hohe Qualität abzuliefern: bewundernswert. |
|
| Bewertung vom 11.11.2025 | ||
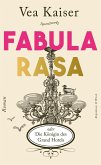
|
Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels “Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels” von Vea Kaiser, die Geschichte einer “Betrügerin aus Mutterliebe”, hat mich restlos begeistert und wunderbar unterhalten. Ganz besonders schön finde ich, dass der Verlag hier mal wieder einem umfangreichen zeitgenössischen Roman von 556 Seiten eine Bühne bereitet hat. Schön, dass Autor*innen mal wieder episch werden dürfen in unserer schnelllebigen Tik-Tok-Zeit, dass man auch mal die kleinen Details erwähnen kann, die das Leben ausmachen. Die Geschichte von Frau Moser wird ausführlich beschrieben und sie braucht diesen Raum, um die Lesenden auf ihre Seite zu ziehen. |
|
| Bewertung vom 11.09.2025 | ||
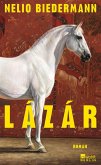
|
Man kann über “Lázár”, diesen klassisch anmutenden Roman, nicht sprechen, ohne auf das geringe Alter seines Autors hinzuweisen - er ist gerade mal 22. In diesem Alter diese Wortgewandtheit, diese Lebensweisheit zu besitzen, um solch einen generationenübergreifenden historischen Roman von besonderer Tragweite zu verfassen, ist ungewöhnlich. Nicht nur seine Schreibweise, die hier zutage tritt, vereint Biedermann mit so manchen klassischen Persönlichkeiten der deutschen Literatur wie Thomas Mann oder Theodor Fontane. Sein junges Alter lässt außerdem den Vergleich mit literarisch Frühvollendeten wie Georg Büchner oder Heinrich von Kleist zu. Nelio Biedermann ist ein literarisches Wunderkind - da sind sich viele einig. |
|
