BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 107 Bewertungen| Bewertung vom 13.01.2026 | ||
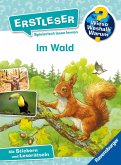
|
Wieso? Weshalb? Warum? Erstleser, Band 17 - Im Wald Wissensvermittlung in Verbindung mit Lesenlernen |
|
| Bewertung vom 05.01.2026 | ||
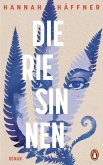
|
Was bedeutet Heimat |
|
| Bewertung vom 08.12.2025 | ||

|
OTTO fährt los - Weihnachten in Finnland Mit Otto in Finnland |
|
| Bewertung vom 26.11.2025 | ||
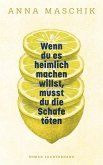
|
Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten Was für ein Debut! |
|
| Bewertung vom 10.11.2025 | ||
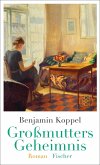
|
Zwiespältiger Eindruck |
|
| Bewertung vom 04.11.2025 | ||
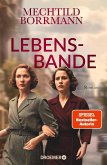
|
Freundschaft in schweren Zeiten |
|
| Bewertung vom 24.10.2025 | ||

|
Frauenpower |
|
| Bewertung vom 13.10.2025 | ||

|
Du musst meine Hand fester halten, Nr. 104 Fesselnd und berührend |
|
| Bewertung vom 06.10.2025 | ||
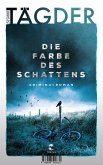
|
Gelungene Fortsetzung |
|
| Bewertung vom 25.09.2025 | ||

|
Das Haus mit der kleinen roten Tür Rundum gelungen |
|
