BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 584 Bewertungen| Bewertung vom 15.12.2025 | ||

|
Parasiten - Meister der Manipulation Mit „Parasiten“ ist Raoul Mazhar und Dr. Hans-Peter Hutter ein ebenso kenntnisreicher wie unterhaltsamer Streifzug durch die schillernde Welt der Schmarotzer gelungen. Die beiden Mediziner öffnen ihren Leser*innen die Augen für ein Thema, das im Alltag oft mit Ekel oder Angst besetzt ist – und verwandeln es in eine ebenso lehrreiche wie vergnügliche Lektüre. |
|
| Bewertung vom 08.12.2025 | ||

|
1,2,3 - fertig ist die Weihnachtsbäckerei Als jemand, der seit Jahrzehnten leidenschaftlich und regelmäßig backt, war ich sehr neugierig auf dieses Weihnachtsbackbuch, das laut Klappentext 45 "blitzschnelle" Rezepte verspricht. Tatsächlich setzt das Buch auf ein Konzept, das eindeutig Zeit spart: Viele Teige werden nicht klassisch ausgerollt und ausgestochen, sondern zu Rollen geformt, von denen man nur noch Taler abschneidet. In der Theorie klingt das wunderbar unkompliziert – in der Praxis hat es bei mir jedoch nicht immer so reibungslos funktioniert. Trotz vorheriger Kühlung im Eisfach und einem wirklich scharfen Messer haben sich manche Teigrollen beim Schneiden stark verformt, sodass einige Plätzchen eher schief als schön rund aus dem Ofen kamen. |
|
| Bewertung vom 02.12.2025 | ||

|
Als Flexitarierin greife ich nicht unbedingt als erstes zu veganen Kochbüchern – aber "Carlottas vegane Küche" hat sich sehr schnell zu einer echten Bereicherung in meinem Küchenregal entwickelt. Die Italienerin Carlotta Perego, erfolgreiche YouTuberin und Bloggerin, lebt überzeugend eine vegane Ernährung vor, und genau diese Leidenschaft spürt man auf jeder Seite. |
|
| Bewertung vom 25.11.2025 | ||
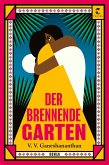
|
Was hatte ich mich auf diesen Roman gefreut! Ich lese leidenschaftlich gerne Geschichten, die in fernen Ländern spielen und mir Einblicke in Kulturen geben, über die ich bisher wenig wusste. Über die leidvolle Geschichte Sri Lankas nach der Unabhängigkeit war mir abgesehen von den brutalen Schlaglichtern des Bürgerkriegs, die es in westliche Nachrichten geschafft hatten, kaum etwas bekannt. Umso größer war meine Vorfreude auf "Der brennende Garten" – und, ja, vielleicht auch mein Wunsch, dieses Buch unbedingt mögen zu wollen. Leider ist mir das nicht gelungen. |
|
| Bewertung vom 12.11.2025 | ||
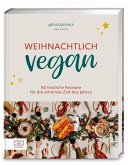
|
Ein lieber Kollege hat seine Ernährung vor einigen Monaten umgestellt, er lebt nun komplett vegan. Da kam dieses hübsch gestaltete Buch für mich wie gerufen, so kann ich ihn mit (vor-)weihnachtlichen Leckereien überraschen. Der erste Test war rundum überzeugend: Ich habe ihm den Gewürzkuchen mit Schokolade gebacken - ein Traum, der Kuchen kam außerordentlich gut an! |
|
| Bewertung vom 31.10.2025 | ||

|
Manchmal begegnet mir ein Buch, das leise und unscheinbar daherkommt – und doch mit einer solchen Klarheit, Tiefe und Schönheit spricht, dass ich nach der Lektüre anders in die Welt blicke. "Von gestern eine Spur" von Marianne Ach ist ein solches Buch. |
|
| Bewertung vom 31.10.2025 | ||

|
Sarah Hall, geboren 1974 in Carlisle, Nordengland, ist eine bedeutende zeitgenössische britische Autorin. Sie ist für ihre kraftvolle, poetische Sprache und ihre schonungslose Gesellschaftskritik bekannt. Die Töchter des Nordens (The Carhullan Army, 2007) wurde vielfach ausgezeichnet und gilt inzwischen als moderner Klassiker feministischer Dystopien. |
|
| Bewertung vom 31.10.2025 | ||
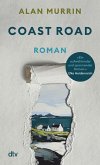
|
Alan Murrin, geboren in Donegal, Irland, ist ein noch junger Autor, der mit Coast Road sein Romandebüt vorgelegt hat. Nach einem Studium des Creative Writing in Dublin und London lebt und arbeitet er heute in Großbritannien. Coast Road wurde vielfach als eindringliches Porträt einer irischen Gesellschaft am Wendepunkt beworben. |
|
| Bewertung vom 10.10.2025 | ||

|
Yuko Kuhns Roman "Onigiri" bewegt sich geschickt zwischen Fiktion und Autobiografie. Sowohl die Autorin als auch ihre Ich-Erzählerin Aki haben einen deutschen Vater und eine japanische Mutter – eine Parallele, die dem Text spürbare Authentizität und emotionale Tiefe verleiht. |
|
| Bewertung vom 16.09.2025 | ||

|
Percival Everetts "Die Bäume", eine bissig-geistreiche Satire über Lynchmorde an Schwarzen fand ich großartig, sein Roman "James", eine Neuerzählung des Klassikers über Tom Sawyer und Huckleberry Finn ließ mich zum Fan seiner Literatur werden. Entsprechend große Erwartungen hatte ich an das neueste Werk aus Everetts Feder. |
|
