BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
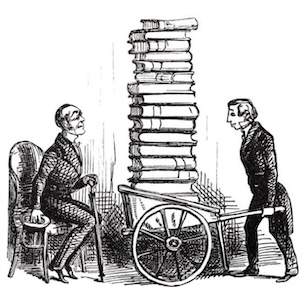
Bewertungen
Insgesamt 340 Bewertungen| Bewertung vom 10.12.2025 | ||

|
Graeber, Anthropologe und anarchistisch geprägter Denker, und Wengrow, Archäologe, dem man die materialistische Nüchternheit zutraut, setzen bei einem Punkt an, den kaum jemand infrage stellt: der angeblich linearen Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Sie rollen alles neu auf, alles anders, alles noch verwirrender als man es schon kennt. Dazu ein Hörbuch-Sprecher, der gerne Kindergeschichten vorliest. |
|
| Bewertung vom 09.12.2025 | ||
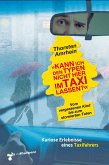
|
'Kann ich den Typen nicht hier im Taxi lassen?' Mitten aus dem verrückten Leben. So empfinde ich dieses Buch, ein Potpourri der skurrilen und unglaublichen Erlebnisse. Wann immer ich Taxi fahre, bleibe ich ruhig und höflich, damit sich der Fahrer auf die Arbeit konzentrieren kann: mich sicher irgendwo hin zu befördern. |
|
| Bewertung vom 08.12.2025 | ||

|
Peter Hoeres analysiert die historische Entwicklung der Begriffe „rechts“ und „links“ von biblischen Wurzeln über die Französische Revolution bis zur Gegenwart. Er argumentiert, dass „rechts“ kulturell lange positiv besetzt war und warnt vor der normativen Zuspitzung des Schemas als Gefahr für den Rechtsstaat. |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||
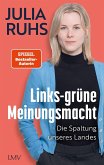
|
Julia Ruhs erinnert daran, dass demokratische Kultur vom Austausch lebt und nicht vom Konsens. Linke glauben immer, dass irgendwann Friede, Freude, Eierkuchen sei, ein grundlegendes Missverständnis. Demokratie ist vor allem Streit, Auseinandersetzung und der Kampf darum, die besseren Argumente zu haben. Sozialisten glauben immer, umfassend recht zu haben und fühlen sich gestört, wenn Sachargumente vorgebracht werden. |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||
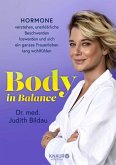
|
„Body in Balance“ ist ein wertvolles Buch für alle Frauen, die ihre Gesundheit besser verstehen und aktiv gestalten möchten. Die erfahrene Gynäkologin und Hormonexpertin Dr. Judith Bildau führt mit großer Empathie und Sachkenntnis durch ein Thema, das oft mit Unsicherheit behaftet ist: unsere Hormone. Dabei zeigt sie, wie stark hormonelle Prozesse das Wohlbefinden in jeder Lebensphase beeinflussen – vom ersten Zyklus über die Wechseljahre bis weit darüber hinaus . |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||
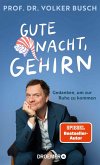
|
„Gute Nacht, Gehirn“ ist ein außergewöhnlich kluges und zugleich zugängliches Buch über etwas, das uns alle betrifft: den Schlaf – und wie sehr unser Gehirn ihn braucht, um gesund, ausgeglichen und leistungsfähig zu bleiben. Die Autorin bzw. der Autor schafft es, wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer Leichtigkeit zu vermitteln, die sowohl unterhaltsam als auch aufklärend wirkt. Schon nach wenigen Seiten merkt man, wie viel Liebe zum Detail und wie viel Neugier am neuen Wissen in diesem Buch steckt. |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||
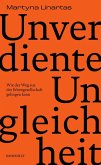
|
Das Buch flankiert einen aktuellen, vor allem von Linken und der SPD vorgebrachten gesellschaftspolitischen Impuls, stützt sich aber wenig auf differenzierte Analysen oder neue Lösungsansätze. Die Argumentation konzentriert sich stark auf moralische Empörung über die ungerechte Vermögensverteilung; dabei bleibt die Herleitung der Ursachen lückenhaft und die konkreten Reformvorschläge wirken oft mehr plakativ als tragfähig. 0 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 28.10.2025 | ||

|
Deutschland in der Warteschleife Schon zu Beginn fesselt mich in diesem Buch dieser Satz: „Ein Wirtschaftsminister als lernender Praktikant, als wäre er stets auf der Suche nach Schwiegermüttern, die sich immer schon so einen Mann für ihre Tochter gewünscht haben und denen er auf Kaffeefahrten locker alle Heizdecken dieser Welt verkaufen könnte.“ In der Tat waren einige Politiker fleißig darin, Bürger an Staatsanwaltschaften zu verpetzen, wenn sich der Bürger humoristisch wehren wollte. Es stimmt, aus der Ampelzeit werden nur Talkshows mit gefallsüchtigen FDP-Vorsitzenden und einer Dame in Erinnerung bleiben. „Die Ampel wird als unwürdiges Spektakel deutscher Politik in die Geschichte eingehen.“ Der Beginn von Bürger-Verfolgungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze hat aktuell die Haudurchsuchung von Prof. Bolz zu einem Höhepunkt geführt. Die Autoren warnen genau vor dieser Entwicklung, angestoßen durch Parteien, die vor allem Angst vor dem Verlust von Ämtern haben. |
|
| Bewertung vom 27.10.2025 | ||
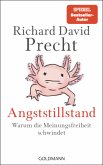
|
Precht argumentiert auf zwei Säulen: Das egalste auf der Welt seien Hautfarben, denn seine Geschwister kämen aus Vietnam. Und der Kapitalismus durchdringe unser Leben auf das negativste in allen Verästelungen, jeder sei heute ein hypersensibles Marketingprodukt seiner selbst. Deswegen würde man heute nichts mehr ertragen und Streit aus dem Weg gehen. Er selbst habe Roger Willemsen auf das heftigste bekämpft, weil dieser damals besser war als er selbst. Erst auf Augenhöhe habe er ihn akzeptiert. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 20.10.2025 | ||

|
Die intellektuelle Selbstzerstörung "Manche Ideen sind so dumm, dass nur Intellektuelle an sie glauben." Das sagte George Orwell und dieser Gedanke trifft vor allem auf die aktuelle westliche Sichtweise einer selbstzerstörerishen Sichtweise auf die eigene Kultur zu. Dieses Buch vermittelt vor allem die Perspektive von Universitäten, die sogar in Amerika zunehmend in der monetären Hand ihrer eigenen Feinde sind. |
|
