BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 43 Bewertungen| Bewertung vom 24.11.2025 | ||

|
Wenn man sich mit den biografischen Splittern befasst hat, die Lahme und Ilies gerade eher mühsam aufgewärmt haben, kann man sich an dieser Briefausgabe erholen. Schon das Vorwort von Erika Mann erfreut durch seine Frische. Der erste Brief an Adorno enthält Anregenderes zur Collagetechnik von Thomas Mann als viele Kommentarbände. Erfreut liest man, dass man Karl K. Valentin auswendig kannte, bewegt, dass er einem 17 jährigen Verehrer den „Josef“ schickte und sich später von ihm fahren ließ – man mag allgemein Bedenken gegen den Nachlass verwaltende Verwandte haben, hier bewährt sich die Mischung aus Kenntnis, Intelligenz und Diskretion. |
|
| Bewertung vom 24.11.2025 | ||

|
Im alten Reich, Lebensbilder deutscher Städte, Band 1 Man sollte sich nur immer wieder neu anregen lassen und beweglich bleiben, weil die Vorlieben der Autorin so schnell wechseln: So lässt sie Kaiser Rudolf, Faust, Luther und König Gustav Adolf durch Erfurt streifen, regt die Phantasie an, indem sie Namen wie Albrecht der Entarteten, Friedrich mit der gebissenen Wange und Eberhard der Greiner erwähnt, ohne ihre Herkunft zu entschlüsseln, erzählt Anekdoten um Kaiser Rudolfs Nase, um die Unabhängigkeit der Esslinger Bürger greifbar zu machen, lässt Erfurter und Esslinger Bürgerfamilien zu Napoleons Besatzung Revue passieren, zeichnet den Aufstieg der Württemberger Grafen und die Entstehung des Klosters Maulbronn, den Reichtum des Ries anhand von Nürtingen nach, beurteilt den Wiederaufbau des Kölner Doms, die Dimensionen der Gebäude in Prenzlau, die Auswirkungen der Politik der Hohenzollern auf den Charakter der Prenzlauer, den Verkauf von Gerichtsbarkeitsrechten in Neubrandenburg und erzählt die Geschichte der „Hexe“ Grete Minde neu. Hätte sie doch nur Fußnoten verwendet, wäre die Vielfalt durch ein Strichwortverzeichnis leichter zu erschließen! |
|
| Bewertung vom 21.10.2025 | ||

|
Das Tagebuch (1880-1937), Band 4 (Das Tagebuch 1880-1937, Bd. 4) Die Gespräche mit Dungern, vielleicht angereichert um die gemeinsam mit Rathenau und Hoffmansthal angestellten Überlegungen und die politische und persönliche Kurzbiographie Hardens könnte eine bessere, präzisere Darstellung der Sexualmoral und des Einflusses ihrer Verlogenheit auf die Biographien der Herrschenden als die üblichen ergeben. Besonders niederschmetternd ist das Bild des Kronprinzen und seiner Frau, eher verständnisvoll das von Wilhelm II, auch oder vielleicht gerade, weil Kessler bei ihm homosexuelle Neigungen denkbar macht. |
|
| Bewertung vom 21.10.2025 | ||
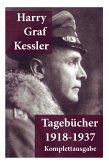
|
Tagebücher 1918-1937: Graf von Kessler Der Band ist, was erreichbar war, bis weitere Tagebücher in Moskau aufgefunden und dann in einer Monumentalausgabe zugänglich gemacht wurden. |
|
| Bewertung vom 07.10.2025 | ||

|
Der Versuch, sozusagen aus der Sicht eines Schriftstellers, kundig durch Herausgeberschaften, die Biographie eines Musikers zu schreiben, misslingt eher. Zerrbilder werden an einander gereiht, die – fast naturgemäß, vielleicht aufgrund des Rückgriffs auf die zitierte, eher an der Musik orientierte Literatur - eine Stellung innerhalb der Musikschriftstellerei, aber kein eigenständiges Leben haben. |
|
| Bewertung vom 07.10.2025 | ||
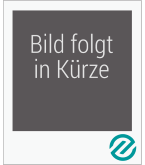
|
Die Frage der Entmythologisierung Ein inhaltlich eher unfreundlich ausgetragener, unübersichtlicher Streit, in dem es um so vieles geht, was Vielen am Herzen gelegen haben dürfte, u. a. wie folgerichtig Seelsorge sein, inwieweit Sachverhalte wie die der Bibel wahrgenommen werden können kann. Bultmann liest sich diesbezüglich recht klar: Wer Christentum beibringen will, hat sich mit den Sprachen der Bibel zu beschäftigen. Schon die Frage, warum das Christentum der Bibel-Autoren wichtiger als das ihrer Exegeten wird nicht behandelt. So deutet sich eine Groteske an, die wohl auch wiederum nur bei weiterer, genauer Lektüre dieses und anderer Werke genauer offen gelegt werden könnte: Der so an der Rekonstruktion der Erfahrung älteren Denkens interessierte Jaspers, dass er ein Werk über die "großen Philosophen" herausgegeben hat, scheint Probleme mit Erkundigungen darüber zu haben, wie die Größe Jesu zu erklären ist. |
|
| Bewertung vom 05.10.2025 | ||

|
Raimund von Doblhoff 1914-1993 Eben sprang mir der Name in den Kopf, und ich freue mich, dass es eine Veröffentlichung über ihn gibt: in den 80-igern studierte ich in München und war oft bei meinen Eltern in Stuttgart, schaute also immer einmal wieder in Augsburg vorbei. Dabei muss ich in einer Ausstellung (eines gemässigt modernen Malers?) auf ihn getroffen sein. Er hatte mich Jungspund angesprochen, von seiner Nähe zum Hause Fugger, seinen Projekten und pointierten Ansichten zur damaligen Diskussion über die Moderne erzählt. Ich weiss nicht mehr, ob wir uns mehrfach trafen. Jedenfalls blieb die Erinnerung über die Jahrzehnte. |
|
| Bewertung vom 19.09.2025 | ||
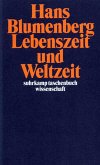
|
Zusammengefasstes Nachdenken über Zeit hat nicht viele Vorbilder. Merkwürdiger ist daher, dass Blumenberg weniger Allgemeines wie die Zeit des Lebens eines Menschen (die ja auch individuelle Gationalitäten begrenzt) oder Vorstellungen über das Ende der Welt, Neues oder Wiederkehrendes und mehr Anekdotisches, etwa erhellend zum Verhältnis zwischen Heidegger und Husserl, behandelt. Eher hintergründig-feullietonistisch ist das, wenn er an Montaignes Zweifel bei der Einführung eines allgemeinen Kalenders erinnert. Zur Philosophie, einer eigenartigen Begrenzung der Freiheit durch den Stand der Entwicklung, kommt Blumenberg bei der Unterscheidung zwischen dem zurück, was er Muss- und Kannzeit nennt. So regt das Buch sehr vielfältig an, beeindruckende Gedankenführung ist aber nicht seine Stärke. |
|
| Bewertung vom 19.09.2025 | ||
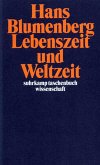
|
Zusammengefasstes Nachdenken über Zeit hat nicht viele Vorbilder. Merkwürdiger ist daher, dass Blumenberg weniger Allgemeines wie die Zeit des Lebens eines Menschen (die ja auch individuelle Gationalitäten begrenzt) oder Vorstellungen über das Ende der Welt, Neues oder Wiederkehrendes und mehr Anekdotisches, etwa erhellend zum Verhältnis zwischen Heidegger und Husserl, behandelt. Eher hintergründig-feullietonistisch ist das, wenn er an Montaignes Zweifel bei der Einführung eines allgemeinen Kalenders erinnert. Zur Philosophie, einer eigenartigen Begrenzung der Freiheit durch den Stand der Entwicklung, kommt Blumenberg bei der Unterscheidung zwischen dem zurück, was er Muss- und Kannzeit nennt. So regt das Buch sehr vielfältig an, beeindruckende Gedankenführung ist aber nicht seine Stärke. |
|
| Bewertung vom 16.09.2025 | ||
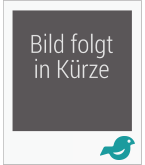
|
Eben habe ich - wie Bewertungen zu löschen sind, weiss ich nicht - ein Buch, das die offenbar eindrucksvolle Leitung der Schlacht im 2. Weltkrieg betraf, rezensiert, als handle es sich um dieses. Beide sind das Durchblättern wert! |
|
