BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 243 Bewertungen| Bewertung vom 09.12.2025 | ||

|
In uns der Ozean (MP3-Download) Rachel Louise Carson (1907- 1964), Meeresbiologin und Wissenschaftsjournalistin, gilt als die Pionierin des Umweltschutzes und des Gedankens der Nachhaltigkeit. Ihr Buch „Der stumme Frühling“ beschwor schon 1962 eindringlich die Gefahren eines Umgangs mit der Natur, der auf Profitmaximierung abzielte. Konkret war es der hemmungslose und unkontrollierte Einsatz des Insektenvertilgungsmittel DDT, den Carson in ihrem Buch ins Visier nahm. |
|
| Bewertung vom 03.12.2025 | ||
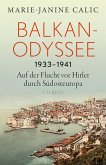
|
Balkan-Odyssee, 1933-1941 (eBook, ePUB) Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 02.12.2025 | ||
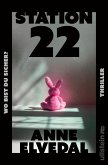
|
Station 22. Wo bist du sicher? (eBook, ePUB) Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 14.11.2025 | ||
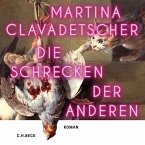
|
Die Schrecken der anderen (MP3-Download) Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 06.11.2025 | ||
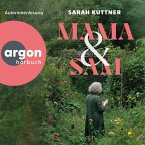
|
Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||

|
Mord in der Willow Street / Ein Fall für Sally und Johnny Bd.3 (eBook, ePUB) Der dritte Band einer wieder entdeckten Krimireihe um das junge Paar Sally und John! Inzwischen sind Sally und John Eltern geworden und leben am Wochenende in einem geerbten Cottage auf dem Lande, wo sie sich dem Gartenbau hingeben – very british. |
|
| Bewertung vom 27.10.2025 | ||
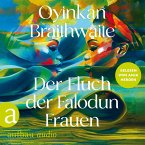
|
Der Fluch der Falodun Frauen (MP3-Download) Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 23.10.2025 | ||
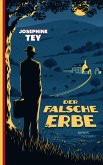
|
Der falsche Erbe (eBook, ePUB) Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 18.10.2025 | ||

|
Der Gärtner und der Tod (eBook, ePUB) Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 16.10.2025 | ||
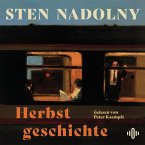
|
Herbstgeschichte (MP3-Download) Mein Hör-Eindruck: |
|
