BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 214 Bewertungen| Bewertung vom 07.01.2026 | ||

|
Japanische Holzschnitte hatten seit dem Impressionismus einen bedeutenden Einfluss auf die westliche Kunst. Auch der Jugendstil zog wesentliche Elemente aus den eleganten Bildfindungen japanischer Druckgrafik, die am Ende des 19. Jahrhunderts in gewaltigen Mengen nach Europa exportiert wurde. Aber es gab auch den umgekehrten Weg: Europäische Einflüsse wanderten zurück nach Japan und inspirierten die dortigen Künstler. Marlene Wagner hat für ihr Buch Beispiele für den modernen japanischen Holzschnitt gesucht und etwa drei Dutzend Künstler und Künstlerinnen mit ihren Werken ausgewählt. In Kurzbiografien wird ihr beruflicher Werdegang, aber vor allem auch die Wechselbeziehung der Künstler untereinander dargestellt, die sich zum einem auf die Heroen der japanischen Holzschnittkunst beziehen, wie Hokusai oder Takahashi Shōkō, auf der anderen Seite aber auch Kirchner, van Gogh oder Warhol zu ihren Vorbildern zählen. Unter dem Begriff shin hanga („Neue Druckkunst“) emanzipierten sich einige Künstler um 1900 auch von den etablierten Verlegerstrukturen und gewannen damit künstlerische Freiheiten, die sie vorher nicht hatten. |
|
| Bewertung vom 04.01.2026 | ||

|
Von den etwa 600 erhaltenen Zeichnungen Michelangelos sind 80 % Männerdarstellungen. Doch was bedeutet das konkret im Kontext seiner Zeit und seiner Werke? Dieser Frage geht „Michelangelo and Men“ im Detail nach. |
|
| Bewertung vom 28.12.2025 | ||

|
Die Asam-Kirche ist in vieler Hinsicht außergewöhnlich. Zum einen gehört sie zu den seltenen Beispielen bürgerlichen Stiftertums, indem sie von den Asam Brüdern Egid Quirin und Cosmas Damian nicht nur gebaut, sondern auch privat finanziert wurde. Auch wenn sie sich damit finanziell überhoben, ist der barocke Prunk von Fassade und Innenraum im Bereich der Privatfrömmigkeit einzigartig, zumal das Wohnhaus Egid Asams zur Linken und das Priesterhaus zur Rechten ebenfalls zum Ensemble gehören. Aber nicht nur handwerklich besticht der Kirchenbau durch Perfektion, sondern das Bild- und Architekturprogramm steckt voller Überraschungen und zeugt vom hohen intellektuellen Niveau des Bauherrn, der die Wechselbeziehungen zwischen Raum und Dekor bewusst inszenierte. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 22.12.2025 | ||
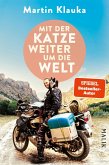
|
Mit der Katze weiter um die Welt Ich muss vorausschicken, dass ich voreingenommen bin: Mogli, die Katze mit der Martin Klauka um die Welt gereist ist, ähnelt unserem Kater Felix, der mich durch 20 Jahre meines Lebens begleitete, fast aufs Haar - nur dass Felix noch einen Schwanz hatte. Aber auch ohne diesen Hintergrund kann man sich in Mogli verlieben. Schon der erste Band erzählte eine unglaubliche und unglaublich süße Geschichte, der zweite ist nicht weniger spannend. Eine Katze, die kein Revier, sondern „einen Menschen hat“, dem sie so vollkommen vertraut, dass sie mit auf Reisen geht, sich alle paar Tage oder Wochen an eine neue Umgebung gewöhnt und dieses aufregende Leben offenbar genießt, denn weggelaufen ist Mogli nie. Heute lebt sie (ja, sie fühlt sich nicht als Kater. Und ist auch keiner.) dauerhaft in Bayern und das geht auch gut so. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 21.12.2025 | ||

|
Hu Anyan gehört zum chinesischen Prekariat. Ohne Hochschulausbildung steht ihm nur der Hilfsarbeitersektor offen und so beschließt er, zunächst Paketbote in der Hauptstadt zu werden. Aber China ist ein Haifischbecken: Die Großen fressen die Kleinen und Hu ist ein ganz kleiner Fisch, dessen Gutmütigkeit zuerst einmal gründlich ausgenutzt wird: Übergriffige Kunden, die ihn als persönlichen Sklaven betrachten, inkompetente Vorgesetzte, hinterhältige Kollegen. Irgendwann stellt Hu zu seinem eigenen Entsetzen fest, dass er selber auch beginnt, seine Menschlichkeit zu verlieren. Das System erschafft die eigenen Monster. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.12.2025 | ||
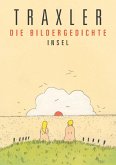
|
Er wird bald 97 und hat den Zeichenstift noch nicht aus der Hand gelegt. Warum auch, wenn die Ideen immer noch sprudeln. Dichten und Denken hält jung. Hans Traxler hat mit seinem subversiven Witz, seinen an Wilhelm Busch geschulten Versen und den aufs Wesentliche reduzierten Zeichnungen einen Stil geschaffen, den man sofort wiedererkennt. Und noch etwas ist ganz typisch für ihn: Traxler ist ein Menschenfreund. Selbst bei der Religion versteht er Spaß, da können sich die Religiösen gerne eine Scheibe abschneiden. Oder zwei. Aber keine Sorge, bei der besonders empfindlichen Religion hält Traxler den Stift immer brav im Zaum, denn auch das verlängert das Leben, wenn der Gegner die Toleranz nur im Munde führt. Traxler ist durch und durch Humanist: ein Aufklärer, ein Spötter und gebildet ist er auch. Seine Leser sollten aus ähnlichem Holz geschnitzt sein. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.12.2025 | ||
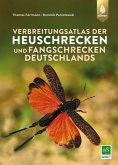
|
Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Deutschlands Viele Heuschreckenarten reagieren besonders empfindlich auf Änderungen in ihrem Biotop, für die meisten aber gilt: Sie mögen es warm. Offenes, sonnendurchflutetes Gelände besitzt die höchste Artendichte und der Klimawandel hat bereits zu einigen bemerkenswerten (und unerwartet schnellen) Wanderungsbewegungen geführt. Die einzige Fangschrecke Deutschlands, die europäische Gottesanbeterin, hat ihr ursprüngliches Areal am Kaiserstuhl längst verlassen und wurde bereits in Niedersachsen nachgewiesen. Und die Gottesanbeterin ist nicht alleine, wie der aktuelle Verbreitungsatlas zeigt. Viele wärmeliebende und mobile Arten breiten sich aus, sesshafte, eher feuchte Biotope bevorzugende Arten werden dagegen seltener. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.12.2025 | ||

|
Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Band 5/IIIB Die Raniden sind die mit Abstand am besten wissenschaftlich untersuchten Amphibien Europas. Der Wasserfrosch ist bereits seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Modellorganismus der taxonomischen Artendifferenzierung, mittlerweile durch molekulargenetische Methoden ergänzt und auf andere Gattungen erweitert. Diese grundlegende Fragestellung durchzieht den Band III B des Handbuchs der Reptilien und Amphibien Europas wie ein roter Faden und macht ihn damit zur mit Abstand aktuellsten und taxonomisch differenziertesten Monografie zu den europäischen Raniden. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.12.2025 | ||

|
Die Kelten in Baden-Württemberg Die letzte umfangreiche und wissenschaftlich aktuelle Monografie über die Kelten in Baden-Württemberg, die sich an eine breite Öffentlichkeit richtete, stammt von 1981. Seitdem hat sich in der Keltenforschung enorm viel getan. Viele vermeintlich gesicherte Erkenntnisse stellten sich als Mythen heraus und einige angezweifelte antike Berichte haben sich durch moderne Methoden als wahr erwiesen. Auch der Fokus der Forschung hat sich verlagert: Während im 19. und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die im Gelände gut sichtbaren Grabhügel und „Fürstensitze“ archäologisch erschlossen wurden, stehen heute die unbefestigten Siedlungen und das Alltagsleben im Zentrum des Interesses. Verfeinerte Materialanalysen, bessere Dokumentation und die Paläogenetik eröffnen mittlerweile ganz neue Möglichkeiten. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.12.2025 | ||
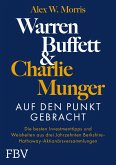
|
Warren Buffett und Charlie Munger - Auf den Punkt gebracht Aktionärsversammlungen sind oft langweilig, schöngefärbt und wenig lehrreich – nicht so bei Berkshire Hathaway, zumindest bisher. Nach dem Tod von Charlie Munger im November 2023 und dem Rücktritt von Warren Buffett Ende 2025 im Alter von 95 Jahren werden sich die Versammlungen jedoch verändern. Geblieben sind die frei zugänglichen Videos aus über drei Jahrzehnten, deren Sichtung allerdings viel Zeit und Mühe erfordert. Alex W. Morris hat diese Arbeit übernommen und die wichtigsten Gedanken der beiden Investoren in seinem Buch „Warren Buffett & Charlie Munger – Auf den Punkt gebracht“ zusammengefasst. Damit eröffnet er Lesern einen kompakten Zugang zu ihrem Denken. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
