BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 970 Bewertungen| Bewertung vom 08.12.2025 | ||
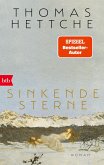
|
Wirkmächtigkeit von Literatur |
|
| Bewertung vom 04.12.2025 | ||

|
Feministisches Märchen |
|
| Bewertung vom 28.11.2025 | ||

|
Fiasko der Selbstüberforderung |
|
| Bewertung vom 23.11.2025 | ||
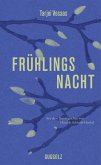
|
Coming-of-Age-Geschichte voller Rätsel |
|
| Bewertung vom 20.11.2025 | ||

|
Weder bereichernd noch unterhaltend |
|
| Bewertung vom 18.11.2025 | ||
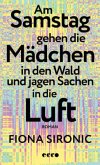
|
Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft Eine Dystopie mit Wumms |
|
| Bewertung vom 16.11.2025 | ||
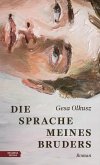
|
Die Sprache meines Bruders Deutscher Buchpreis 2025 Longlist Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit |
|
| Bewertung vom 15.11.2025 | ||

|
Auf der Suche nach Identität |
|
| Bewertung vom 11.11.2025 | ||
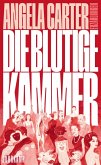
|
Gruselige Täter-Opfer-Umkehr |
|
| Bewertung vom 07.11.2025 | ||

|
Magerer Plot und stilistisches Können |
|
