BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 10 Bewertungen| Bewertung vom 19.10.2025 | ||
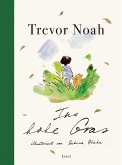
|
Trevor Noah ist ein südafrikanischer Comedian, der bereits ein sehr erfolgreiches autobiografisches Werk namens „Born a crime“ veröffentlicht hat. Dieses habe ich schon einige Zeit auf meiner To-do-Liste und nun steht der Plan, es in Kürze zu lesen. |
|
| Bewertung vom 16.10.2025 | ||
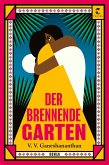
|
In dem Roman der US-Autorin V. V. Ganeshananthan erzählt diese die Geschichte von Sashi, beginnend im Jahr 2009, Ort: NYC. Sehr schnell aber springen wir ins Jahr 1981, nach Sri Lanka. Und von dort aus wird in der ersten Person aus Sicht eben jener Sashi berichtet. Immer wieder wird der Leser einbezogen, indem er direkt angesprochen wird. Diese kleine Technik erzeugt tatsächlich eine größere Nähe zu den Personen, denen man begegnet und v.a. zu Sashi. |
|
| Bewertung vom 20.09.2025 | ||
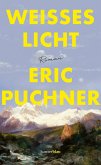
|
Eric Puchner hat mit „Weißes Licht“ einen sehr interessanten Roman geschrieben, der nicht sehr leicht zu bewerten ist. Aber eins nach dem anderen. Es wird zunächst in aller Ausführlichkeit erzählt, wie Cece und Charlie sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Charlies bester Freund Garrett soll die beiden trauen. Doch, als der zurückgezogen lebende Garrett erkennt, dass er sich zu Cece hingezogen fühlt, nehmen die Dinge einen völlig unkontrollierten Lauf. Vielmehr darf man zu dieser Geschichte nicht erzählen, um das Leseerlebnis nicht zu beeinträchtigen. |
|
| Bewertung vom 21.08.2025 | ||

|
Percival Everett ist ein genialer Schriftsteller. Dies ist der vierte Roman von ihm, den ich gelesen habe. Und eine derartige literarische Bandbreite ist mir tatsächlich selten begegnet. Denn jeder Roman war anders, jeder Roman war besonders. |
|
| Bewertung vom 10.08.2025 | ||
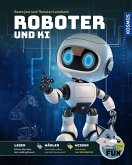
|
Kosmos SchlauFUX Roboter und KI Mit einem tollen und gut durchdachten Konzept für Kinder ab 8 Jahren glänzt dieses Sachbuch mit den Themen KI und Robotics. Ich habe es mit meinem Neffen (9 Jahre) gelesen, der es sofort super-interessiert zur Hand genommen hat. Ich selbst hatte vor wenigen Wochen eine Tagung mit einem Zukunftsforscher und habe zahlreiche seiner Themen hier wiedererkannt. Das war auch insofern spannend, als ich erkennen konnte, wie gut das Buch recherchiert ist. Tatsächlich habe ich nichts vermisst. Auf je einer Doppelseite wird ein Kapitel behandelt. So bleibt es spannend und bunt, damit zu arbeiten. In welcher Reihenfolge das gemacht wird, ist dabei unerheblich. Die Kids werden sogar dazu animiert thematisch zu springen. Mein Daumen geht deutlich nach oben. Es ist für Kinder gemacht, aber selbst für Erwachsene als Einstieg in die Themenwelt geeignet. |
|
| Bewertung vom 08.07.2025 | ||
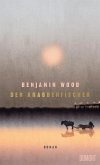
|
Benjamin Wood erzählt hier die Geschichte von Thomas, einem jungen Mann, der allein mit seiner Mutter lebt und sich als Krabbenfischer im Großbritannien der Sechzigerjahre verdingt. Jeden Morgen fährt er mit seinem Pferd heraus an den Strand, um dort sein täglich Brot zu verdienen. Er führt ein einfaches, teils hartes Leben, ist mit wenig zufrieden, hat bescheidene Träume. Es gibt ein Mädchen, die Schwester seines Freundes, die ihn fasziniert. Aber er traut sich nicht, sie anzusprechen. Und er träumt davon, Musiker zu sein, und wenn es nur ein Auftritt auf einer heimischen Bühne mit seiner Gitarre ist. Eines Tages kommt ein Fremder in das Dorf und fragt Thomas, ob er ihm helfen kann, den Strand besser kennen zu lernen, weil er plant dort einen Film zu drehen. Denn der Fremde ist ein Regisseur, ein Freigeist, der seine Kreativität kaum zügeln kann. |
|
| Bewertung vom 15.05.2025 | ||

|
In Ocean Vuongs neuem Buch erzählt er die Geschichte von Hai, einem vietnamesisch-stämmigen Jungen aus einem kleinen Ort in New England. Bereits im ersten Kapitel wird man als Leser in eine raue, harte Wirklichkeit hereingezogen. Wie eine Stimme aus dem Off wird die Stadt mit all ihren unangenehmen Seiten beschrieben. Man hat das Gefühl, dass jemand erzählt, der dort lebt. Das ist technisch gut gemacht, aber man bekommt direkt und ungeschönt ein Gefühl davon, was einen im weiteren Verlauf des Romans erwartet. |
|
| Bewertung vom 14.04.2025 | ||
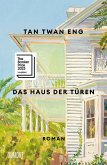
|
Der Roman des malaysischen Autors Tan Twan Eng ist auf drei Zeitebenen angesiedelt - dem Jahr 1921, als einer der beiden Hauptprotagonisten, Willie Somerset Maughan, seines Zeichens Schriftsteller, nach Penang kommt, um seinen alten Freund Robert zu besuchen und sich von einer Schreibblockade zu befreien. Er wird begleitet von seinem Sekretär und Geliebten Gerald. Lesley, Roberts Frau, ist die zweite Hauptprotagonistin und wird Willie zum Schreiben einer neuen Geschichte animieren. Dazu wird der Leser ins Jahr 1910 zurückversetzt werden. Auf dieser Ebene erzählt ausschließlich Lesley in der Ich-Form. Den Rahmen bildet dann noch die dritte Ebene, welche im Jahr 1947 angesiedelt ist. |
|
| Bewertung vom 31.03.2025 | ||
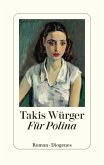
|
Unmittelbar vor Takis Würgers neuem Roman „Die Brüder Karamasow“ von Fjodr Dostojewskij gelesen zu haben, ist Fluch und Segen zugleich. Denn im Grunde kann nach einem solchen Jahrhundertroman jedes andere Werk daneben nur verblassen. Dazu später mehr. Auf der anderen Seite ist es wohl Schicksal gewesen, dass bereits nach wenigen Seiten der Name dieses großen russischen Autors fiel - und zwar nicht nur einmal. Es stellt sich schnell heraus, dass Würger sein Buch nach einer Figur aus einem Roman Dostojewskijs („Der Spieler“) benannt hat… |
|
| Bewertung vom 31.03.2025 | ||
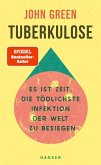
|
In seinem neuen Buch schreibt John Green, der große Autor von „Eine wie Alaska“, „Margos Spuren“ oder „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, keinen neuen Roman, sondern ein Sachbuch. Es geht dabei um Tuberkulose, die Krankheit, welche wahrscheinlich die meisten Menschenleben, auf unserem Planeten gekostet hat. Und doch ist sie für die meisten von uns eine große Unbekannte… |
|
