BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 30 Bewertungen| Bewertung vom 10.12.2025 | ||

|
Im Februar 1933 begibt sich Thomas Mann in Begleitung seiner Frau Katia und der jüngsten Tochter Elisabeth auf eine Vortragsreise über Richard Wagner mit anschließendem Erholungsurlaub in der Schweiz. Bei ihrer Abreise ahnen sie noch nicht, dass sie nicht zurückkehren werden. Es sind die politisch hellsichtigen Kinder Erika und Klaus, die den Eltern die verschlüsselte Botschaft telefonisch überbringen. Und weil beide nicht glauben, was sie hören, macht sich Erika schließlich selbst auf den Weg in die Schweiz, nicht ohne Thomas Manns aktuelles Manuskript des „Joseph und seine Brüder“ und wichtige Bücher im Gepäck. Zu diesem Zeitpunkt hat Heinrich Mann, getarnt als Handlungsreisender, Deutschland schon längst Richtung Frankreich verlassen. Zu Fuß ist er mit Koffer und Regenschirm über die Rheinbrücke ins Nachbarland, weil er es nicht wagte, eine Fahrkarte nach Straßburg zu lösen. Seine Partnerin Nelly kann ihm erst Monate später, nach vielen Repressalien, folgen. Erika kehrt noch einmal zurück nach Deutschland, begleitet von ihrer Schwester Elisabeth, die weiter zur Schule gehen soll. Das erweist sich schnell als Fehler, denn Katia Mann ist Jüdin, und somit ihre Kinder für das neue tausendjährige Reich ebenso. Golo fällt die Aufgabe zu, die Fünfzehnjährige sicher wieder in die Schweiz zu bringen. Aber nicht nur das. Golo ist es auch, der einen großen Teil des Familienvermögens rettet, bevor dieses eingezogen wird, und der Thomas Manns Tagebücher, um die dieser sich außerordentlich sorgt, in die Schweiz expediert. Und der Monika, die gerne vergessene, ungeliebte mittlere Tochter, aus Berlin rausholt. Monika, glücklich, der Familie entkommen zu sein, hatte noch gar nicht bemerkt, was vor sich geht. Und so findet sich die ganze Familie im Frühsommer in Sanary in Südfrankreich wieder. Sie sind nicht allein, sondern in guter Nachbarschaft der Feuchtwangers, der (Arnold) Zweigs, von Bertolt Brecht, Ludwig Marcuse, René Schickele und einigen anderen mehr, auch Aldous Huxley residiert dort. Die Crème de la Crème der deutschen Literatur und Kultur. |
|
| Bewertung vom 30.11.2025 | ||

|
In einer verständlichen Sprache, keinerlei Vorkenntnisse voraussetzend, breitet Michel Abdollahi aus, warum anti-demokratisches Gedankengut, Verschwörungstheorien und Fake News so viele Anhänger haben und warum die AfD mit ihren Ideen so viel Zustimmung findet. 2013 zunächst als Anti-Europa-Partei gegründet, stellt sie heute, gerade mal 12 Jahre später, die zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag. Warum ist das so? In einer immer komplexer werdenden Welt sehnen sich viele nach einfachen Antworten und Erklärungen, haben Angst vor weiteren Veränderungen, sind enttäuscht, möchten den regierenden Alt-Parteien einen Denkzettel verpassen. Das mögen auch die Gründe sein, warum die AfD zuerst in den neuen Bundesländern erfolgreich war: viele ostdeutsche Bürger haben nach 1990 genug von Veränderungen und wünschen sich die Beschaulichkeit der 90er Jahre zurück. Er erläutert auch sehr detailliert, welchen Anteil die Medien an der Entwicklung haben. Einerseits kommen sie ihrem Informationsauftrag nach, andererseits haben sie wirtschaftliche Interessen. Provozierende und populistische Aussagen, die zu Zustimmung oder Widerspruch auffordern, verkaufen und verbreiten sich besser als sachliche Informationen. Außerdem gilt in der deutschen Presse, dass alle Parteien entsprechend ihrer Größe in den Parlamenten zu Wort kommen dürfen. Das ist z. B. In Luxemburg und Wallonien/Belgien nicht so. Dort wird Rechten/Rechtsextremen keine Bühne bereitet, sondern Interviews werden nur zusammengefasst wiedergegeben. |
|
| Bewertung vom 23.11.2025 | ||

|
Mascha Kalékos Gedichte und ihre Kurzprosa begeistern mich sehr, und warum sie solange in Vergessenheit geraten konnte, ist mir unverständlich. Wie ein Komet tauchte sie in der Endphase der Weimarer Republik unter den Autoren auf, ein Erfolg, der jäh endete, als „die paar leuchtenden Jahre“ vorbei waren. Zwar wurden ihre Werke nicht verbrannt, ihr Erstling „Das lyrische Stenogrammheft“ erschien noch 1933 im Rowohlt Verlag. 1938 ist sie mit Mann und Sohn in die USA emigriert, wo sie für siebzehn Jahre in New York ein neues Zuhause fand. 1956 will Rowohlt ihr Buch neu auflegen, und Mascha nimmt dies zum Anlass, sich auf eine ausgedehnte Europareise zu begeben. Es ist ihre erste Rückkehr nach dem Krieg, etwa ein Jahr wird sie bleiben. Volker Weidermann fokussiert sich in seiner Biografie auf dieses eine Jahr, von hier aus erzählt er rückblickend und vorausschauend vom Davor und Danach und ergänzt seinen Text an vielen Stellen durch den Einschub der entsprechenden Gedichte. Mascha hatte lange gezögert, ihre Zustimmung zur Neuauflage zu geben, und als sie es dann tat, hatte sie eine große Erwartungshaltung, sie wollte so gerne wieder Dichterin sein. Sie war glücklich, lang vermisste Freunde zu treffen, wieder in Deutschland zu sein, in Berlin vor allem. Hier wieder zu leben, zu schreiben, dass konnte sie sich vorstellen. |
|
| Bewertung vom 02.11.2025 | ||
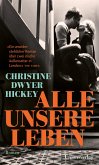
|
Aus dem Englischen von Kathrin Razum. Milly und Pip, der eigentlich Phillip heißt, begegnen sich 1979 erstmals in einem Londoner Pup, in dem Milly hinter dem Tresen steht. Beide sind jung, beide sind Iren im Londoner Exil. Es ist eine Begegnung fürs Leben und gleichzeitig auch nicht, denn Zufälle, die falschen Ereignisse im falschen Augenblick verhindern, dass sie ein Paar werden, obwohl jedes Wiedersehen im Verlauf von beinahe 40 Jahren eine neue Chance sein könnte. Könnte, denn das Leben, das beide beutelt, kommt immer wieder dazwischen. Dabei verläuft Millys Leben über lange Phasen relativ konstant, sie fühlt sich wohl in London und hat in Mrs Oaks Pub für lange Zeit ein Zuhause gefunden. Pip dagegen wird vom Leben herumgetrieben und ist nirgendwo zu Hause. |
|
| Bewertung vom 01.11.2025 | ||

|
Geboren ist Rilke in Prag, am 4. Dezember 1875. Dieses Jahr wäre sein 150. Geburtstag. Ihm zu Ehren soll die Journalistin Ellen über sein Leben schreiben. Nun, eine große Rilke-Liebhaberin ist sie nicht, hat ihn für sich unter „Trauerkartenbeschrifter“ abgespeichert. Sie muss sich zunächst ein Bild von ihm machen. Wo ginge das besser als in Worpswede, wo sich ausgewiesene Rilke-Kenner treffen werden. Dort beginnt Ellen mit ihrer Recherche. |
|
| Bewertung vom 26.10.2025 | ||
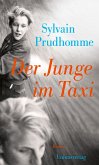
|
Aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer. |
|
| Bewertung vom 02.10.2025 | ||
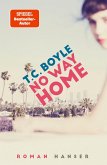
|
No Way Home (deutschsprachige Ausgabe) Erkennt er die Abwärtsspirale nicht, in die sie ihn zieht? Das habe ich bis zum Schluss nicht begriffen. Aber - that’s life, ich kann mich da nur wiederholen. In der Liebe setzt der Verstand aus, oder wechselt die Etage, oder beides. Vermutlich weiß er, dass sie nicht gut für ihn ist, und sie weiß, dass der Ex nicht gut für sie ist. Tja. Wie kommt mann/frau da raus? Das ist genau die Frage, für die es keine Lösung gibt. |
|
| Bewertung vom 10.09.2025 | ||

|
„Aber alle Regeln haben sich geändert, und es ist schwer, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie immer weitermachen, als wäre alles ganz normal.“ Zitat von Seite 554. |
|
| Bewertung vom 12.08.2025 | ||
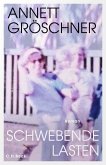
|
Hanna hätte meine Großmutter sein können. Im Deutschen Kaiserreich geboren und wenige Jahre nach der Wiedervereinigung gestorben, hat sie in 5 deutschen Systemen gelebt und zwei Weltkriege überstanden. Aufgewachsen ist sie als jüngste inmitten von vier Schwestern in Magdeburg. Dort hat sie mit einer kurzen Unterbrechung in Berlin ihr ganzes Leben verbracht, ihren Karl geheiratet, 6 Kinder bekommen und den Schrecklichkeiten des Zwanzigsten Jahrhunderts getrotzt. Hanna hat furchtbare Dinge gesehen und erlebt, Dinge, mit denen man kaum weiterleben kann. Aber sie hat nie aufgegeben, ist immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht, weil man eben weitermacht, irgendwie, und wurde so der Inbegriff einer resilienten, widerständigen Frau. |
|
| Bewertung vom 11.08.2025 | ||

|
Ach war das schön! Das erste Mal seit vielen Jahren habe ich einen Roman in einem Rutsch weggelesen, war abgetaucht, nicht ansprechbar. Ich habe mich so unglaublich zu Hause gefühlt in diesem Buch. Die B 96 durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern - wie oft bin ich die selbst gefahren von Leipzig nach Greifswald und/oder in Gegenrichtung. Die weitläufigen Strände und die Steilküsten der wunderschönen Insel Rügen, der fassungslose Blick auf die Ruine und später den sanierten Koloss von Prora - das habe ich alles mit eigenen Augen gesehen. Und wie lebendig kommt die Erinnerung an durchtanzte Nächte in viel zu lauten Lokalitäten zurück, in denen auch ich es, ähnlich wie Hedwig, leider nie so gut aushalten konnte. Für mich ist dieser Roman wahrlich ein großes Geschenk. |
|
