BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 274 Bewertungen| Bewertung vom 01.12.2024 | ||

|
Ein Hund, ein Garten – ein Neubeginn einer talentierten Frau. Literarisch einmalig! |
|
| Bewertung vom 29.11.2024 | ||
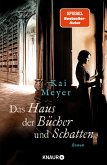
|
Das Haus der Bücher und Schatten Ein spannungsgeladener Thriller aus dem Graphischen Viertel in Leipzig! |
|
| Bewertung vom 27.11.2024 | ||
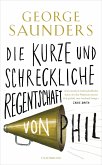
|
Die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil Eine treffende Parabel auf unsere machthungrige Gesellschaft, wunderbar erzählt. |
|
| Bewertung vom 17.11.2024 | ||

|
Ein Krimi in Wien, Psychoanalytiker mit Herz und dubiose Starärzte |
|
| Bewertung vom 14.11.2024 | ||

|
Der Kampf um mehr Frauenrechte in Italien! Literarisch genial umgesetzt! 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 12.11.2024 | ||

|
Geniale Leseunterhaltung. Subtil, spannend. Literarisch anspruchsvoll |
|
| Bewertung vom 10.11.2024 | ||
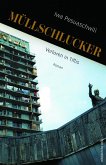
|
Die neuere Geschichte Georgiens in einem Tag einer Familie zusammengefasst! Grandios! |
|
| Bewertung vom 06.11.2024 | ||
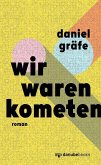
|
Ein rasantes Roadmovie mit dem politischen Hintergrund Rumäniens |
|
| Bewertung vom 03.11.2024 | ||
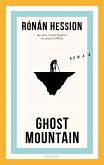
|
Ein herrlich ruhiges Buch, tiefsinnig und unterhaltsam über das Abenteuer „Leben“ |
|
| Bewertung vom 01.11.2024 | ||
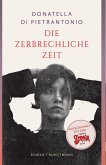
|
Eine gesellschaftliche Momentaufnahme aus den Abruzzen, einfühlsam erzählt. 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
