BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 203 Bewertungen| Bewertung vom 03.11.2024 | ||

|
Der deutsche Kunstvermittler Ernst Grosse ist tatsächlich nur noch einigen Fachleuten ein Begriff. Er war zwischen 1906 und 1913 in Japan und China als Einkäufer für die neugegründete ostasiatische Abteilung der Berliner Museen unterwegs und auch vorher knüpfte er schon wertvolle Verbindungen zum japanischen Kunstmarkt. Obwohl er wesentlich zum Grundbestand der Sammlung beitrug und auch seine eigene Kollektion dem Museum stiftete, war ihm die meiste Zeit seines Lebens die Anerkennung verwehrt. Das klingt nach einem spannenden Thema, das sich aufzuarbeiten lohnt. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.11.2024 | ||
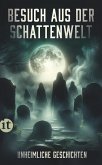
|
Sammlungen von Gruselgeschichten gibt es immer wieder und ich bin ein Fan davon, seit ich lesen kann. „Besuch aus dem Schattenreich“ ist eine besonders gelungene Mischung aus echten Klassikern und neuen Entdeckungen, wobei „neu“ nicht heißt, dass die Texte wirklich neu sind. Bis auf einen haben alle Autoren das Schattenreich bereits selber betreten, ohne dass ihre Werke in irgendeiner Weise altmodisch geworden wären. Der älteste Text erschien bereits 1820 und ich kannte zwar die Geschichte, aber bisher nur als Film: „Sleepy Hollow“ hat sich dann aber als eine echte Entdeckung erwiesen, denn Washington Irving schreibt dermaßen witzig und originell, dass ich mir sofort einen antiquarischen Band mit seinen Kurzgeschichten zugelegt habe. „Sleepy Hollow“ ist aber auch genial übersetzt! 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 02.11.2024 | ||
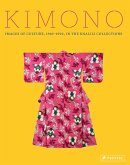
|
Kimono gehören zur japanischen Kultur wie Kalligrafie und Teezeremonie. Zu offiziellen Veranstaltungen werden sie noch heute getragen, von Männern wie Frauen, auch wenn ihre Bedeutung mit jeder neuen Generation schwindet. Nasser David Khalili besitzt nach eigenen Angaben eine der größten Kimonosammlungen der Welt, in Teilen bereits 2015 publiziert, die einen besonderen Fokus auf die sogenannten „omoshirogara“ Textilien legt. „Omoshirogara“ zeigen programmatische Motive, die oft auch der zeitgenössischen Populärkultur entstammen und die ab dem Ende der Meiji-Ära weite Verbreitung fanden. Zusammen mit neuen Textildruckverfahren begleiteten sie auf ihre Weise den gesellschaftlichen Umbruch. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.10.2024 | ||
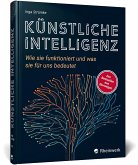
|
Wird uns die Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft wirklich helfen oder haben wir die Büchse der Pandora geöffnet? Inga Strümke, Professorin für KI und maschinelles Lernen, ist da durchaus zwiegespalten. Sie sieht zwar Chancen, aber auch erhebliche Risiken in dieser Technologie, wenn sie nicht staatlich reguliert wird. In ihrem Buch erklärt sie, wie KI funktioniert, was sie heute kann (und was nicht) und welche Auswirkungen KI heute und in Zukunft auf uns haben wird. Mit ihrer verständlichen, lebendigen Sprache und ihrer sachlich differenzierten Herangehensweise gelingt es der Autorin, sowohl Einsteiger, die noch nicht viel über KI wissen, anzusprechen, als auch den fortgeschrittenen Leser zu fesseln. Nicht umsonst ist das Buch in Strümkes Wahlheimat Norwegen zum Bestseller geworden. 4 von 4 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 22.10.2024 | ||
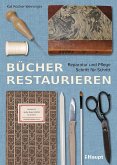
|
Alte Bücher haben es schwer. Der Wertverfall bei Buchauktionen ist dramatisch, so dass sich professionelle Restaurierungen beschädigter Bücher nur noch in seltensten Fällen lohnen. Aber man kann tatsächlich vieles auch selber machen, mit überschaubarem finanziellen Aufwand, etwas Geduld und Ausdauer. Kat Rücker-Weininger ist gelernte Buchbinderin und zeigt, wie sowas geht. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 09.10.2024 | ||
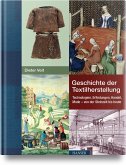
|
Geschichte der Textilherstellung Zur Geschichte der Textilherstellung gibt es erstaunlich wenig zusammenfassende Literatur, wenn man bedenkt, dass wir mit diesen Produkten wirklich täglich umgehen. Und das seit Tausenden von Jahren. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 09.10.2024 | ||
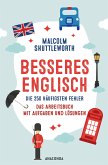
|
Besseres Englisch. Die 250 häufigsten Fehler. Das Arbeitsbuch mit Aufgaben und Lösungen „Actual“ heißt nicht aktuell, ein „desert“ kann man nicht essen und mit einem „handy“ auch nicht telefonieren. Im Englischen nennt man diese fehlgeleitete Intuition „false friends“ und falsche Freunde gibt es für uns Deutsche eine ganze Menge. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.10.2024 | ||

|
Nach ihrer Gründung im Jahr 1776 waren die USA sehr lange auf der Suche nach einer eigenen Identität. Die Architektur orientierte sich noch bis ins 20. Jahrhundert an Europa, dessen Stile man weitgehend unverändert übernahm. Um 1920 entwickelt sich dann ein typisch amerikanischer Baustil, initiiert von Architekten, die zwar in Europa ausgebildet wurden, sich aber zunehmend emanzipierten. Zunächst noch eine Mischung aus Art déco und industriellen Anklängen (klassisch: das Chrysler Building), wird Frank Lloyd Wright die amerikanische Architektur revolutionieren und in seinem Windschatten etablieren sich weitere Titanen der Architektur, die zeitlose Werke hinterlassen haben. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.10.2024 | ||
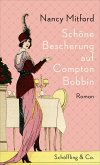
|
Schöne Bescherung auf Compton Bobbin Der Schriftsteller Paul Fotheringay ist todunglücklich über seinen neuen Roman, der sich gerade zum Bestseller entwickelt. Gedacht als Tragödie, wird er aus berufenem Munde zum „lustigsten Buch des Jahres“ erklärt, worauf Paul aus Scham inkognito zum abgelegenen Compton Bobbin flüchtet, wo er sich als Hauslehrer hat anstellen lassen. Doch ganz so abgeschieden ist Compton Bobbin dann doch nicht, denn zur Weihnachtszeit pflegt sich die weit verzweigte Familie um Lady Bobbin zu versammeln und darunter sind einige Personen, die Paul nicht unter dem Namen „Fisher“, sondern Fotheringay kennen. Außerdem ist er in einer geheimen Mission unterwegs, die Lady Bobbin ganz und gar nicht gutheißen würde... 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
