BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 207 Bewertungen| Bewertung vom 25.05.2022 | ||

|
Als Virginia Woolf 1925 im eigenen Verlag ihren vierten Roman "Mrs. Dalloway" veröffentlichte, galt dieser als stilistisch und sprachlich revolutionär, weil er mit den gewohnten erzählerischen Konventionen brach. Mehr als jeder andere Roman zuvor. Und auch sie selbst notierte in ihrem Tagebuch: "Ich glaube ganz ehrlich, dass dies der gelungenste meiner Romane ist." So erfahren wir es im Klappentext der jüngsten Ausgabe, die kürzlich in der Manesse Bibliothek erschienen ist. Es handelt sich dabei um eine deutsche Neuübersetzung von Melanie Walz, ergänzt und aufgewertet durch ein Nachwort der österreichischen Schriftstellerin Vea Kaiser. |
|
| Bewertung vom 23.05.2022 | ||

|
Da ist der Barkeeper, der sich bei den härtesten Gangstern des Viertels anbiedert und zuhause seine Freundin verprügelt. Da ist der Mann, der das Geld für die teure Behandlung seines todkranken Vaters einfach verjubelt. Da ist das Mädchen, das mit nahezu jedem Mann Sex hat, bevor es sich von der Brücke stürzt. Und da ist der Alkoholiker, der für eine neue Wohnung seine Grundsätze über den Haufen wirft und wieder anfängt zu trinken. Sie alle sind gescheiterte oder tragische Antiheld:innen voller Schmerz und Melancholie. Und sie sind die Hauptfiguren in Un-Su Kims Kurzgeschichtenband "JAB", der kürzlich im Europa Verlag erschienen ist. |
|
| Bewertung vom 19.05.2022 | ||
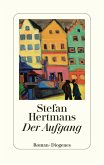
|
Eher zufällig erfährt Autor Stefan Hertmans: 20 Jahre hat er in Gent in einem Haus gelebt, in dem über viele Jahre der flämische SS-Kollaborateur Willem Verhulst mit seiner Familie lebte. Hertmans begibt sich auf eine jahrelange Recherche, um die Spuren der früheren Bewohner:innen sichtbar zu machen und findet dabei nicht nur zahlreiche persönliche Geschichten heraus, sondern auch deren Verbindung zum Land Belgien und dessen Konflikte, die teilweise bis heute andauern... |
|
| Bewertung vom 09.05.2022 | ||

|
Die 34-jährige Grundschullehrerin Rachel Cameron führt in der kanadischen Provinzstadt Manawaka ein ereignisloses Leben. Während sie zuhause ihre pflegebedürftige Mutter umsorgt und dafür die meiste Zeit aufbringt, findet sie auch im Berufsleben nicht wirklich Anschluss. Als ihr ehemaliger Mitschüler Nick für den Sommer nach Hause kommt, scheinen sich die Dinge schlagartig zu ändern. Rachel beginnt mit dem ein Jahr älteren Mann eine Affäre, die für sie nicht folgenlos bleibt... 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.05.2022 | ||
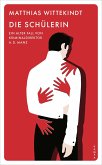
|
Die Schülerin / Kriminaldirektor a.D. Manz Bd.1 Als Kriminaldirektor a. D. Manz von seiner Tochter erfährt, dass sie als Anwältin gerade eine Mandantin wegen eines vermeintlichen Meineids vertritt, gehen bei ihm die Warnlichter an. Jene Sabine Schöffling erinnert ihn nämlich an einen alten Fall aus dem Jahre 1978, als sich die damals 16-jährige Schülerin als Zeugin in einem Mordfall nicht gerade kooperativ verhielt. Nach und nach kehren seine Gedanken zurück zu diesem Fall, als ein 15-jähriger Junge tot aufgefunden wurde, den niemand zu vermissen schien. Im Fokus seiner damaligen Ermittlungen: die Elisabeth-Rotten-Schule, eine Berliner Reformschule, und deren seltsame Lehrer- und Schülerschaft... |
|
| Bewertung vom 03.05.2022 | ||
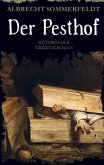
|
1619, vor den Toren Hamburgs: Auf dem Hamburger Berg liegt der Pesthof - ein Ort, an dem sich der Aussatz der Hamburger Gesellschaft befindet, um sich auf sein mehr oder weniger langes Dahinsiechen vorzubereiten. Zwischen den Schwindsüchtigen, Tollen und Gichtkranken befindet sich auch Merten Overdiek, ein Hamburger Kaufmann, der zwischen all den Verstoßenen eine Sonderrolle einnimmt. Einerseits genießt er wegen seiner Bildung und seines Wohlstands ein durchaus hohes Ansehen. Doch andererseits ist er selbst unter den Kranken und geistig Verwirrten ein Außenseiter. Denn Merten hat Lepra und darf nicht einmal mit dem Rest des Hofes die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Als es auf dem Pesthof zu diversen mysteriösen Todesfällen kommt, ergreift Merten die Gelegenheit, der Einsamkeit auf dem Hof zu entkommen und macht sich kurzerhand selbst an die Ermittlungen. Eine Entscheidung, die nicht nur ihn, sondern auch die ihn unterstützende Pflegefrau Maria in höchste Gefahr bringt... |
|
| Bewertung vom 02.05.2022 | ||
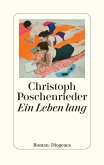
|
Eine Journalistin wird von ihrem Verlag damit beauftragt, ein Buch über einen aufsehenerregenden Mordfall und den verurteilten Mörder zu schreiben. Aus diesem Anlass kontaktiert sie die damalige Clique des Mannes, die während des Gerichtsprozesses mit aller Macht versuchte, die Unschuld ihres Freundes zu beweisen. Wie lebt es sich, wenn ein nahestehender Mensch seit mehr als 15 Jahren im Gefängnis sitzt? Und kann man überhaupt mit einem Mörder befreundet sein? Diese Fragen stellt Christoph Poschenrieder in seinem neuen Roman "Ein Leben lang". |
|
| Bewertung vom 25.04.2022 | ||

|
Als der Doktorand Wolfgang seine kleine Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg bezieht, ahnt er noch nicht, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf sein zukünftiges Leben haben wird. Denn direkt gegenüber wohnt eine junge Frau, die nachts am Küchenfenster sitzt und zeichnet. Aus der anfänglichen Faszination der Beobachtung entwickelt sich eine Art Obsession, die auch nicht schwächer wird, als Wolfgang die Identität seiner Nachbarin entschlüsselt: Es ist Charlotte, Teilnehmerin seines Literaturseminars an der Universität... |
|
| Bewertung vom 21.04.2022 | ||

|
New York in den 1850er-Jahren: An der Wall Street führt ein namenloser Anwalt ein recht genügsames Leben. Um große Fälle bemüht er sich gar nicht erst, in seiner Kanzlei herrscht der alltägliche Bürowahnsinn. Dies ändert sich zunächst auch nicht, als er mit Bartleby einen neuen Schreibgehilfen einstellt. Der unauffällige, blasse Mann arbeitet äußerst fleißig und gewissenhaft. Doch eines Tages lehnt Bartleby es schlichtweg ab, seine Arbeit noch einmal Wort für Wort zu prüfen. "Ich möchte lieber nicht", lautet seine Antwort, die zum geflügelten Wort wird. Denn es bleibt nicht bei dieser einen Verweigerung... |
|
| Bewertung vom 19.04.2022 | ||

|
Als Andrew Green am Freitag, dem 13. November 1903 am hellichten Tage vor seinem Haus erschossen wird, steht die Polizei vor einem Rätsel. Zwar steht mit Cornelius Williams der Täter von Beginn an fest, doch was war das Motiv des Mannes? Über die Suche danach und über das Leben des "Vaters von Greater New York" schreibt Jonathan Lee in seinem neuen Roman "Der große Fehler". |
|
