BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 960 Bewertungen| Bewertung vom 22.07.2024 | ||

|
Amnesie statt Anästhesie |
|
| Bewertung vom 17.07.2024 | ||
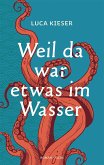
|
Alles ist letztendlich Nichts |
|
| Bewertung vom 14.07.2024 | ||

|
Literarische Zumutung |
|
| Bewertung vom 11.07.2024 | ||

|
Verrat und Gegenverrat im Teenager-Milieu |
|
| Bewertung vom 09.07.2024 | ||
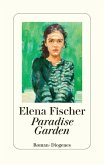
|
Mix aus Coming-of-Age und Roadnovel |
|
| Bewertung vom 06.07.2024 | ||

|
Intellektueller Höhenflug |
|
| Bewertung vom 03.07.2024 | ||
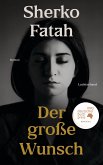
|
Innere Befreiung im islamistischen Getto |
|
| Bewertung vom 01.07.2024 | ||

|
Literatur als Widerstand gegen die Zeit |
|
| Bewertung vom 27.06.2024 | ||

|
Muna oder Die Hälfte des Lebens Gefahren toxischer Männlichkeit |
|
| Bewertung vom 25.06.2024 | ||
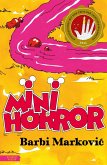
|
Amüsante literarische Avantgarde |
|
