BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 544 Bewertungen| Bewertung vom 27.07.2022 | ||
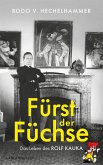
|
Als 1977 Geborener muss ich gestehen, dass ich mit Fix und Foxi nur wenig in Berührung gekommen bin. Bussi Bär fand in meiner Kindheit auch nicht statt und Asterix und die Schlümpfe kenne ich nur im nicht eingedeutschten Original. Daher kannte ich auch den Namen Rolf Kauka vor der Lektüre von Bodo V. Hechelhammers Biografie des vor rund 20 Jahren verstorbenen „deutschen Walt Disney“ nicht. Das Buch mit dem Titel „Fürst der Füchse“ ist eine lesenswerte und aufschlussreiche Aufarbeitung des Lebens von Rolf Kauka – und zeigt den Verleger nicht unbedingt als den cleveren und äußerst geschäftstüchtigen Visionär, der er war, sondern vielmehr als sehr zwiespältigen und eher unsympathischen Charakter. So hatte ein kreatives Verhältnis zur Wahrheit, war getrieben ehrgeizig und seinem Erfolg hatte sich alles und jeder, nicht zuletzt seine Familie, unterzuordnen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 20.07.2022 | ||

|
„Ich bin Kapitalist. Mir gehört ein Viertel von Bahlsen, da freue ich mich schon drüber.“ Mit diesen Worten redete sich Verena Bahlsen 2019 um Kopf und Kragen. Dass sie mit ihrem Geld auch weiterhin Segeljachten und so was kaufen möchte, war da nur ein Sahnehäubchen. Um Jachten und so was ging es auch in einem Interview mit einer anderen schwerreichen Deutschen: „Manche glauben, dass wir ständig auf einer Jacht im Mittelmeer herumsitzen“, so Susanne Klatten, Milliardärin und Mitglied des Quandt-Clans, als sie betonte, wie hart ihr Leben sei („Wer würde mit uns tauschen wollen?“). Was die beiden gemeinsam haben, hat der Wirtschaftsjournalist David de Jong in seinem Buch „Braunes Erbe. Die dunkle Geschichte der reichsten deutschen Unternehmerdynastien“ beleuchtet. Exemplarisch erzählt er am Beispiel der Unternehmerfamilien Quandt, Porsche, Flick, von Finck und Oetker über ihren Aufstieg in der Nazizeit. Dabei schlägt er in dem informativen, interessanten und äußerst lesenswerten Buch einen Bogen vom Damals der Kaiserzeit zum Heute, von den Patriarchen zu den oben genannten Erben der Dynastien. |
|
| Bewertung vom 18.07.2022 | ||
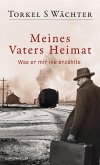
|
Michaël Wächter war wohl ein vielseitiger Mensch. Unter anderem arbeitete er als Leiter des militärpsychologischen Instituts und als Hochschullehrer und er schrieb bis zu seinem Tod Kolumnen für schwedische Zeitungen. Genauso kannte Torkel S Wächter seinen Vater. Als Michaël Wächter 1983 starb, räumte der 1961 geborene Torkel zusammen mit seiner älteren Schwester den Nachlass des Vaters in Kartons, diese verschwanden dann für fast 20 Jahre auf seinem Dachboden. Als Torkel beginnt, sie durchzusehen, ändert sich sein Leben ein für allemal und er findet nicht nur einen völlig neuen Zugang zu seinem Vater, sondern auch zu sich selbst. Das Ergebnis einer Suche, auf die er sich gar nie machen wollte, hat er in seinem dokumentarischen Roman „Meines Vaters Heimat“ niedergeschrieben, das schwedische Original mit dem Titel „Ciona“ schrieb er unter dem Pseudonym „Tamara T.“ – um „den Text für sich selbst sprechen zu lassen“. Ein bedrückendes Werk über zwei Generationen, die in unterschiedlicher Weise durch den 2. Weltkrieg und den Holocaust beeinflusst wurden. |
|
| Bewertung vom 07.07.2022 | ||
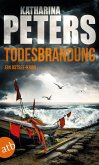
|
Todesbrandung / Emma Klar Bd.7 Mit „Todesbrandung“ hat Katharina Peters einen neuen Teil ihrer Serie um die Privatermittlerin Emma Klar vorgelegt. Und, obwohl das Buch bereits der siebte Band der „Ostsee-Krimi“-Reihe ist, besticht er durch seine Spannung, eine gekonnt konstruierte Geschichte und sauber ausgearbeitete Charaktere – sowohl bei den „Guten“ als auch bei den „Bösen“. Peters präsentiert ihrem Publikum einen verworrenen Fall mit einem teuflischen Puppenspieler und bringt ihre Protagonistin in höchste Gefahr und die Leserschaft um die Nachtruhe. Schön ist auch das Wiedersehen mit „alten Bekannten“: Emmas Lebensgefährte Christoph (Inhaber einer Securityfirma) und der ehemalige Journalist Jörg Padorn sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Letzterer greift Emma auch in diesem Band mit seinen Recherchen unter die Arme. |
|
| Bewertung vom 05.07.2022 | ||
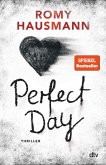
|
„Perfect Day“ war mein erstes Buch von Romy Hausmann und es lässt mich zwiegespalten zurück. Einerseits fand ich den Zugang zur Handlung vor allem am Anfang schwierig, andererseits konnte ich das Buch aber auch nicht aus der Hand legen, da die Neugier auf den Schluss überwog. Insgesamt wird der Thriller mir nicht im Gedächtnis bleiben. Oder vielleicht werde ich mich doch an ihn erinnern, unter der Überschrift: schwierige Charaktere tun schwer nachvollziehbare Dinge. |
|
| Bewertung vom 27.06.2022 | ||
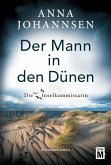
|
Menschen verschwinden. Ältere Menschen verschwinden. Schwerreiche Menschen verschwinden. Reinhardt Dormann ist 79 Jahre alt, Reeder aus Hamburg und verschwindet am hellichten Tag am Strand von Sylt. Damit beginnt Anna Johannsens neues Buch „Der Mann in den Dünen“. Es ist der erste Fall für Kriminalhauptkommissarin Lena Lorenzen nach ihrer Elternzeit (insgesamt aber schon der neunte Teil der „Inselkommissarin“-Reihe) und sie und ihr Kollege Johann Grasmann stoßen auf ungeahnte Schwierigkeiten. Denn die Kinder des Verschwundenen sind nicht wirklich hilfreich bei den Ermittlungen und nach und nach tauchen Dinge auf, die das Leben des Reeders wenig harmonisch erscheinen lassen, aber reichlich Potential für einen spannenden bieten, vor allem, als nach kurzer Zeit Blutspuren am Strand gefunden werden. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 27.06.2022 | ||
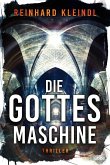
|
Die Idee hinter „Die Gottesmaschine“ von Reinhard Kleindl hat mich als Agnostiker sehr angesprochen: ein mathematischer Beweis der Existenz Gottes, das Thema interessiert mich enorm. Herausgekommen ist für mich aber ein eher halbgarer Thriller vor der malerisch-gruseligen Kulisse eines abgelegenen Klosters und eine Geschichte, die mich abwechselnd an Umberto Ecos „Der Name der Rose“ und Dan Browns Robert-Langdon-Reihe erinnerte. Knackige Episoden mit packender Spannung wechselte sich für mich mit langatmigen Passagen ab, sodass mich das Buch letzten Endes nicht wirklich begeistern konnte. |
|
| Bewertung vom 21.06.2022 | ||
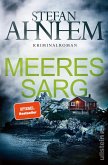
|
Kurz gesagt: „Meeressarg“ war mein erstes Buch von Stefan Ahnhem – aber ganz sicher nicht mein letztes. Da ich in vielen Rezensionen gelesen habe, man könne den sechsten Band um den schwedischen Polizisten Fabian Risk nur mit Vorkenntnissen aus den anderen Teilen der Serie lesen und verstehen, war ich sehr unsicher und habe mir bei meinem dänischen Streaming-Anbieter auch schon die anderen fünf Teile besorgt, aber meine Befürchtungen haben sich als unnötig herausgestellt. Ja, vielleicht hätten mir Vorkenntnisse mehr Einblick gegeben, vor allem, da Fabian Risk in „Meeressarg“ keine so große Rolle spielt, aber meine Begeisterung für das Buch ist auch so groß und ich werde auf jeden Fall die anderen Bücher des Autors auch noch lesen. |
|
| Bewertung vom 17.06.2022 | ||

|
Um Elke Heidenreichs Buch „Hier geht’s lang“ eine lohnende Lektüre zu finden, muss man die Autorin nicht mögen. So ging es mir auf jeden Fall. Es war mein erstes Buch der Autorin und ich denke ernsthaft darüber nach, noch mehr von ihr zu lesen. Denn die Reise durch ihr Leben anhand der Bücher, die sie im entsprechenden Lebensabschnitt gelesen hat, hat mich nicht nur gut unterhalten, ich habe mich in vielem wiedergefunden. 2 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.06.2022 | ||
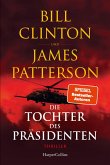
|
Nach „The president is missing“ haben Bill Clinton und James Patterson mit „Die Tochter des Präsidenten“ ihren zweiten gemeinsamen Politthriller vorgelegt, sonst haben die beiden Bücher allerdings nichts miteinander zu tun. Zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, sieht sich der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Matthew Keating der Rache eines alten Bekannten ausgesetzt. Da er seinerzeit den Angriff befohlen hat, bei dem Frau und die drei Töchter von Asim al-Aschid zu Tode kamen, schlägt dieser nun zurück und befiehlt die Entführung von Keatings 19jähriger Tochter Mel. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. |
|
