BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 973 Bewertungen| Bewertung vom 15.11.2025 | ||

|
Auf der Suche nach Identität |
|
| Bewertung vom 11.11.2025 | ||
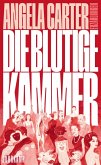
|
Gruselige Täter-Opfer-Umkehr |
|
| Bewertung vom 07.11.2025 | ||

|
Magerer Plot und stilistisches Können |
|
| Bewertung vom 05.11.2025 | ||

|
Parodie auf den Literaturbetrieb |
|
| Bewertung vom 24.10.2025 | ||

|
Ein gar nicht stiller Roman |
|
| Bewertung vom 19.10.2025 | ||
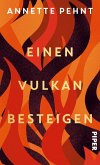
|
Am Rande des Schweigens |
|
| Bewertung vom 15.10.2025 | ||
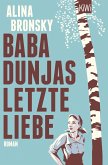
|
Ein Wink an den Leser |
|
| Bewertung vom 10.10.2025 | ||
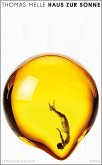
|
Sterben als Therapie |
|
| Bewertung vom 04.10.2025 | ||
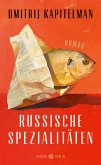
|
Ein Roman mit Ukraine-Bonus |
|
| Bewertung vom 01.10.2025 | ||

|
Alles über Heather (eBook, ePUB) Eine unerhörte Begebenheit |
|
