BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 775 Bewertungen| Bewertung vom 31.01.2021 | ||
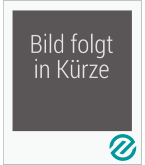
|
Die Säure, um die es in diesem Buch geht, ist die Magensäure. Im Falle eines Rückflusses der Magensäure in die Speiseröhre kommt es zu Sodbrennen. Behandelt wird Sodbrennen oft mit Mitteln, die die Magensäure reduzieren, obwohl die Ursache darin bestehen kann, dass nicht zu viel, sondern zu wenig Magensäure vorhanden ist. |
|
| Bewertung vom 31.01.2021 | ||
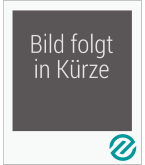
|
„Der Leser sollte daher nicht überrascht sein, wenn er diese Einführung mehr als einmal lesen muss, um Kants Sicht der Dinge richtig einschätzen zu können.“ (7) |
|
| Bewertung vom 31.01.2021 | ||

|
Der offene Himmel: Eine moderne Astronomie Mit der kopernikanischen Wende, also dem Wechsel vom geozentrischen hin zum heliozentrischen Weltbild, wurde die Neuzeit eingeläutet. „Im Gegensatz zu früher konnte nunmehr das Universum bei einer konsequenten Durchdenkung des kopernikanischen Systems nicht mehr geschlossen sein.“ (28) Die eigentliche Wende bestand in den Folgen für das Selbstverständnis der Menschen. |
|
| Bewertung vom 31.01.2021 | ||
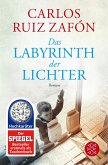
|
Das Labyrinth der Lichter / Barcelona Bd.4 Das liebe ich an den Barcelona-Romanen von Carlos Ruiz Zafón: Die Leser werden eingesogen in die Geschichte, in den Strudel der Ereignisse und werden selbst Teil des komplexen Beziehungsgeflechts. Man möchte eingreifen in den einen oder anderen Handlungsstrang, muss sich aber mit der Rolle des Beobachters auf einer Metaebene begnügen. |
|
| Bewertung vom 30.01.2021 | ||
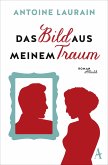
|
Der Anwalt und Kunstsammler Pierre-Francois Chaumonts hat einen wiederkehrenden seltsamen Traum (53), in dem er sich in einer apokalyptischen Szenerie befindet. Auf die eigene Vernichtung folgt eine Begegnung mit einer verschwommen erkennbaren Frau. In dem Traum geht es um Liebe, Identität und einen neuen Weg. Und das ist der Kern, um den es auch in dem Buch geht. |
|
| Bewertung vom 30.01.2021 | ||
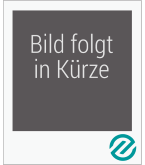
|
"So lebt der Mensch" ist der dritte von vier großen Romanen, die André Malraux in der Zeit von 1928 bis 1937 veröffentlichte. Das Buch erschien 1933 und prägte wegen der Aufarbeitung elementarer Daseinsfragen Malraux' Ruf als Frühexistenzialist. Im Fokus stehen die Würde des Menschen und sein Streben nach Freiheit. Als realer Rahmen dient der Aufstand kommunistischer Arbeiter in Schanghai im Jahre 1927. |
|
| Bewertung vom 30.01.2021 | ||
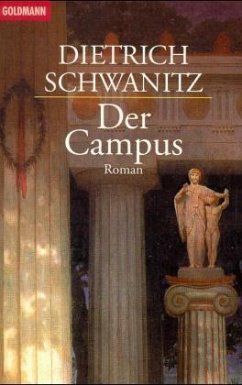
|
An der Uni braut sich was zusammen. Hanno Hackmann, Professor für Soziologie, ist in einen Skandal verwickelt. Er soll Studentin Barbara Clauditz vergewaltigt haben. Eine Kolonne Bauarbeiter hat ihn durch ein Fenster beobachtet. Aus einer Affäre wird ein Fall für den Staatsanwalt. |
|
| Bewertung vom 30.01.2021 | ||
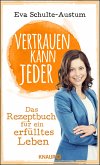
|
Welche Zutaten sind erforderlich, um eine Vertrauenskultur zuzubereiten? Wirtschaftspsychologin Eva Schulte-Austum beschäftigt sich schon lange mit dem Thema. Sie hat in ihrem Buch die notwendige Rezeptur zusammengestellt. Diese besteht aus neun wesentlichen Bestandteilen, deren Bedeutung für das Gesamtergebnis sie ausführlich beschreibt. |
|
| Bewertung vom 30.01.2021 | ||

|
In „Hundert Jahre Einsamkeit“ erzählt Gabriel García Márquez die Geschichte der Familie Buendia, die einst das abgelegene Dorf Macondo gegründet hat, über sieben Generationen. In diesem Mikrokosmos vermischen sich Wirklichkeit und Fantasie, Mythos und Traum. Es ist die Geschichte Lateinamerikas, heruntergebrochen auf das Dorf Macondo und die Familie Buendia. |
|
