BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 544 Bewertungen| Bewertung vom 19.04.2022 | ||

|
Du darfst nicht alles glauben, was du denkst Ich gestehe, dass ich Kurt Krömer bis zu seiner „Chez Krömer“-Sendung mit Torsten Sträter nicht kannte. Geschweige denn, dass ich wusste, dass sich hinter der Kunstfigur ein Komiker und Schauspieler namens Alexander Bojcan verbirgt. Kurt Krömer mag nicht ganz mein Fall sein und ich kann nicht behaupten, ein Fan zu sein. Aber sein Buch „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Meine Depression“ war wirklich unterhaltsam und manchmal auch hilfreich. Da er sich in der Sendung mit Torsten Sträter ja praktisch schon „nackig gemacht hat“, war das Buch nichts wirklich Neues, aber es enthält mehr Details zu dem, was er im Fernsehen schon erzählt hat. Ein schonungsloser Bericht über dunkle Zeiten und die Schwierigkeiten, sich das alles einzugestehen. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.04.2022 | ||
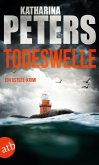
|
Freunde von spannenden Krimis mit vielen Verdächtigen und falschen Spuren sind mit „Todeswelle“ von Katharina Peters hervorragend bedient. Wie von der Autorin gewohnt, präsentiert sie einen Ostsee-Krimi mit vielen interessanten Charakteren und ebenso interessanten Wendungen. Ihr Publikum tappt, wie auch ihre Haupt-Ermittlerin Emma Klar, auf dem Wege zur Lösung des Falls lange im Dunkeln. Die Privatdetektivin unterstützt auch in ihrem sechsten Fall das BKA mit ihrer unkonventionellen Art und Kenner der Serie treffen auf einige alte Bekannte. |
|
| Bewertung vom 12.04.2022 | ||

|
SCHULD! SEID! IHR! / Liebisch & Degenhardt Bd.2 Zu Anfang tat ich mich mit Michael Thodes Buch „Schuld! Seid! Ihr!“ zugegebenermaßen schwer. Der theaterstückartige Aufbau machte mir das Hineinkommen in den Thriller etwas holprig. Aber als ich mich daran gewöhnt habe, dass das Buch in sechs Akte gegliedert ist, von dem jeder einem Opfer gewidmet ist und außerdem jedes Kapitel mit einer Art „Regieanweisung“ überschrieben ist, ließ es mich nicht mehr los. Denn eigentlich sind die Beschreibungen sehr nützlich: man weiß immer, wo sich die Charaktere befinden, in welchem der Zeitstränge das Kapitel spielt und aus welcher Perspektive es erzählt wird. Da das Buch für mich am Anfang ziemlich undurchschaubar war, waren solche Fakten durchaus hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.04.2022 | ||

|
„Einmal Skyeman, immer Skyeman“ – deswegen kehr Kieran MacKinnon nach 20 Jahren Haft zurück in die Heimat. Und damit beginnt nicht nur Mara Laues Buch „Talisker Blues“, sondern auch seine eigene Reise. In die Vergangenheit, in die Zukunft und irgendwie auch zu sich selbst. Denn schließlich kann er sich an den Mord, den er damals begangen haben soll, gar nicht erinnern. Ja, das Rad hat die Autorin mit ihrem Buch nicht neu erfunden, dafür folgt sie zu sehr altbekannten Mustern. Aber sie hat mich mit dem Krimi bestens unterhalten und das ist genau das, was ich erwartet habe. |
|
| Bewertung vom 04.04.2022 | ||
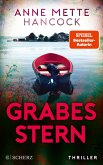
|
Grabesstern / Heloise Kaldan Bd.3 Nach „Leichenblume“ und „Narbenherz“ ist „Grabesstern“ von Anne Mette Hancock der dritte Teil der Serie um die Investigativjournalistin Heloise Kaldan und Kriminalkommissar Erik Schäfer. Das Buch ist vielschichtig und spannend, hat einige unerwartete Wendungen und ist alles in allem ein solider Krimi. Obwohl es der dritte Teil ist, kann man das Buch natürlich auch ohne Vorkenntnisse lesen, alles Notwendige wird aufgegriffen, sodass es keine Verständnisprobleme gibt. Das einzige Manko ist, dass sich für mich wieder einmal bestätigt hat, dass ich Bücher besser im Original lesen sollte, denn die deutsche Übersetzung machte mir aufgrund handwerklicher Schwächen wesentlich weniger Freude als die dänische Fassung. Aber alles in allem fand ich das Buch besser und spannender als den Vorgänger. |
|
| Bewertung vom 31.03.2022 | ||
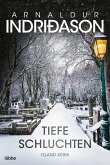
|
Tiefe Schluchten / Kommissar Konrad Bd.3 (eBook, ePUB) Dass ein packender Krimi keine übermäßige Gewalt oder Blutvergießen braucht, zeigt das neue Buch von Arnaldur Indriðason ganz deutlich. „Tiefe Schluchten“ lebt vielmehr von der Atmosphäre und verlangt dem Publikum einiges an Konzentration ab. Daher fand ich die Lektüre anstrengender als bei den meisten anderen Krimis. Zugegeben, er ist der einzige isländische Autor, der mir namentlich bekannt war, das Buch war allerdings mein erstes von ihm. Aber sicher nicht mein letztes, denn sein Stil und das feine Gespür für Zwischentöne haben mich beeindruckt und die Lektüre des Buchs zu etwas Besonderem gemacht. Die Geschichte an sich fand ich zwar gut konzipiert und spannend, aber das wahre Highlight für mich war die Fähigkeit des Autors, eine enorm düstere und bedrückende Atmosphäre zu schaffen. |
|
| Bewertung vom 21.03.2022 | ||
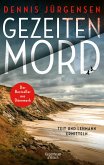
|
Gezeitenmord / Teit und Lehmann ermitteln Bd.1 2022 scheint ein Jahr der wirklich guten Krimis zu werden. Zumindest habe ich dieses Jahr schon einige wirklich gute Bücher dieses Genres gelesen. „Gezeitenmord“ von Dennis Jürgensen ist auf jeden Fall auch eines davon. Von der ersten Seite an hat der Krimi über die deutsch-dänische Zusammenarbeit von Lykke Teit und Rudi Lehmann mich gefesselt. Einzig die vielen Anglizismen haben mich gestört, aber das ist nur ein winziger Kritikpunkt in einer Fülle von Lob. |
|
| Bewertung vom 16.03.2022 | ||
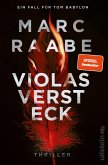
|
Violas Versteck / Tom Babylon Bd.4 Wow. Einfach nur wow. „Violas Versteck”, der vierte und letzte Teil von Marc Raabes Reihe um Tom Babylon hat mich einfach nur komplett überrollt. Noch jetzt, ein paar Stunden nach Lektüre der letzten Seite fühle ich mich, als hätte mich ein LKW überfahren. Das Buch ist auf den ersten Blick konzeptionell ein heilloses Durcheinander, inhaltlich aber einer der mit Abstand rasantesten und spannendsten Thriller, die ich in der jüngeren Vergangenheit gelesen habe. Ich habe mich sehr auf das Buch gefreut und wurde zu keiner Zeit enttäuscht. |
|
| Bewertung vom 10.03.2022 | ||

|
Wie können Ermittlungen gegen eine rechtsradikale Gruppierung und deren Waffengeschäfte mit einem 20jährigen Abiturjubiläum verknüpft sein? Eigentlich vermutlich gar nicht. Dass das aber der Grundstoff für einen rasanten Thriller sein kann, beweist Anne Nørdby mit ihrem neuen Buch „Kalter Fjord“ und legt damit den dritten Teil um den Skanpol-Ermittler Tom Skagen vor. Und nimmt ihr Publikum nicht nur mit auf eine Kreuzfahrt, sondern auch auf eine Reise in Gewalt, verklärte Ideologien und Flashbacks. |
|
