BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 962 Bewertungen| Bewertung vom 20.02.2022 | ||

|
Verklärte historische Sicht 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 29.01.2022 | ||

|
MIt der Geschwindigkeit des Sommers Bedrückendes Psychogramm |
|
| Bewertung vom 27.01.2022 | ||
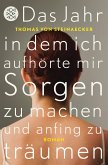
|
Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen, und anfing zu träumen Unvereinbar konträre Welten 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 17.01.2022 | ||
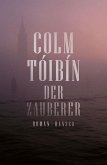
|
Porträt eines Großschriftstellers 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 17.01.2022 | ||
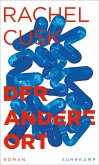
|
So what? 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.01.2022 | ||

|
Der Flug ist das Leben wert |
|
| Bewertung vom 10.01.2022 | ||
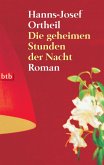
|
Die geheimen Stunden der Nacht Misslungener narrativer Clou |
|
| Bewertung vom 06.01.2022 | ||

|
Inverse Heiligen-Legende 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.12.2021 | ||
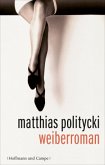
|
Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau |
|
| Bewertung vom 23.12.2021 | ||

|
Liebe in einer verhunzten Welt |
|
