BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 962 Bewertungen| Bewertung vom 19.07.2021 | ||
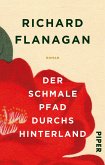
|
Der schmale Pfad durchs Hinterland Beklemmende Lektüre |
|
| Bewertung vom 12.07.2021 | ||
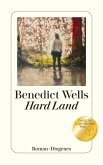
|
Bittersüßer Roman |
|
| Bewertung vom 08.07.2021 | ||
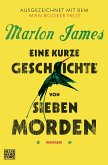
|
Eine kurze Geschichte von sieben Morden Blutrünstiger Karibik-Thriller |
|
| Bewertung vom 05.07.2021 | ||

|
Ebenso scharfsinnig wie amüsant |
|
| Bewertung vom 03.07.2021 | ||

|
Nur für Ornithologen |
|
| Bewertung vom 27.06.2021 | ||
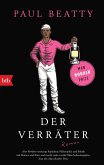
|
Literarischer Gangsta-Rap |
|
| Bewertung vom 23.06.2021 | ||
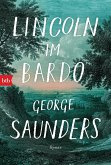
|
Nicht einfach zu lesen, aber lohnend |
|
| Bewertung vom 20.06.2021 | ||

|
Surreale Parabel |
|
| Bewertung vom 15.06.2021 | ||
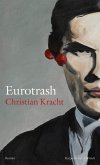
|
Kracht lässt es wieder krachen 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
