BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 246 Bewertungen| Bewertung vom 16.09.2025 | ||

|
Der Duft des Wals (eBook, ePUB) Ein Ehepaar will seine Ehe retten und fliegt mit seiner Tochter in ein Luxusresort nach Mexiko. Die äußeren Voraussetzungen stimmen also: Sonne, Meer, Pool, All inclusive. Doch schon am nächsten Morgen zeigt sich die Kehrseite des vermeintlichen Paradieses: ein gestrandeter und explodierter Wal, der das gesamte Resort in einen bestialischen Gestank einhüllt. |
|
| Bewertung vom 07.09.2025 | ||
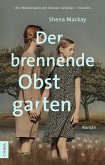
|
Der brennende Obstgarten (eBook, ePUB) London, Sommerferien, und die Lehrerin April Harlency, geschieden und einsam, sitzt in ihrer kleinen Wohnung in einem heruntergekommenen Haus und einem ebenso ungepflegten Garten. Sie denkt zurück an einen Sommer ihrer Kindheit und beschließt, den Ort dieses Sommers wieder aufzusuchen: sie fährt nach Stonebridge in Kent. Stück für Stück verliert sie sich in Kindheitserinnerungen, die die Autorin mit der Gegenwart vermengt, und der Leser geht mit April zurück ins Jahr 1953. Eine Zeit, in der im idyllischen Stonebridge Schilder in den Fenstern hingen wie: „Zimmer zu vermieten. Keine Schwarzen. Keine Iren. Keine Haustiere.“ |
|
| Bewertung vom 03.09.2025 | ||

|
Das Geschenk des Meeres (eBook, ePUB) An der Küste der schottischen Insel Skerry wird ein Kind angespült, und in mir tauchte sofort das schreckliche Bild des 2jährigen kurdischen Flüchtlingskindes auf, das vor Jahren an der türkischen Küste angespült wurde. Das kurdische Kind war tot, das Kind des Romans aber lebt. Ein Fischer findet es, und der Pfarrer bittet Dorothy, sich des Kindes anzunehmen. Dorothy war vor Jahren als Lehrerin in das Dorf gekommen, wo sie aber immer eine Außenseiterin blieb. Das Findelkind ähnelt ihrem im Meer vermissten Sohn Moses, dessen Leiche nie gefunden wurde. Um seinen Tod ranken sich daher bald vielerlei Gerüchte und Schuldzuweisungen, aber auch mythische Vorstellungen von den sog. Wellenkindern der Anderwelt, die Menschenkinder zum Spielen ins Meer locken. Schmerzliche Erinnerungen werden in Dorothy wach, und schließlich ist sie der Auffassung, dass das Meer ihr ihren Sohn als Geschenk zurückgegeben habe: das Meer nimmt und das Meer gibt. Die Geschichte spitzt sich zu, als die wahren Eltern des schiffbrüchigen Kindes gefunden werden. |
|
| Bewertung vom 03.09.2025 | ||

|
Der Krabbenfischer (MP3-Download) Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 15.08.2025 | ||
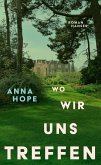
|
Wo wir uns treffen (eBook, ePUB) Das Cover zeigt einen bestechend schönen englischen Landsitz, und schon weiß man als Leser, dass es in diesem Roman um eine Familiengeschichte geht, um Reichtum, um Traditionen, Geschichte und auch um Standesbewusstsein. |
|
| Bewertung vom 04.08.2025 | ||
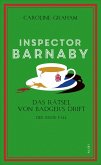
|
Inspector Barnaby und das Rätsel von Badger's Drift Badger’s Drift ist ein beschaulicher kleiner Ort auf dem Lande mit dem „Inventar“, das der Leser erwartet: romantische Cottages, ein Herrenhaus, schrullige, aber selbstbewusste alte Damen, ein exzentrischer Maler, Jagdgesellschaften, Teekränzchen, natürlich ein Pub und ein Frauenclub, und auf der Polizeistation arbeitet man noch mit Karteikarten und Hängeregistraturen.Die Damen tragen Hüte mit blumigen Dekor und besuchen Ikebana-Kurse – kurz: die Welt ist in Ordnung. In diese Idylle platzt ein Mord, dem weitere folgen werden, und Inspector Barnaby nimmt seine Ermittlungen auf. |
|
| Bewertung vom 02.08.2025 | ||

|
Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 31.07.2025 | ||

|
Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 30.07.2025 | ||

|
Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 17.07.2025 | ||
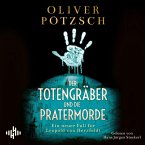
|
Der Totengräber und die Pratermorde / Inspektor Leopold von Herzfeldt Bd.4 (MP3-Download) Mein Hör-Eindruck: |
|
