BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 116 Bewertungen| Bewertung vom 11.11.2024 | ||
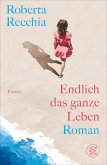
|
Kitsch as Kitsch can |
|
| Bewertung vom 08.10.2024 | ||
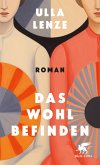
|
Verschenkte Sujets |
|
| Bewertung vom 01.10.2024 | ||
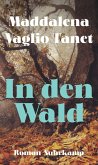
|
Vielerlei Einsamkeit |
|
| Bewertung vom 30.08.2024 | ||
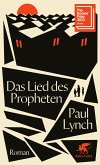
|
Abgrund |
|
| Bewertung vom 20.08.2024 | ||

|
Impressionistische Skizze |
|
| Bewertung vom 19.08.2024 | ||
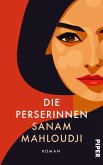
|
Sozialstudien in rüdem Ton |
|
| Bewertung vom 10.07.2024 | ||
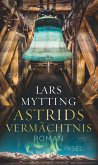
|
Zeiten und Menschen |
|
| Bewertung vom 16.06.2024 | ||
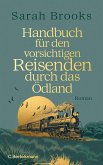
|
Handbuch für den vorsichtigen Reisenden durch das Ödland Genre-Mix |
|
| Bewertung vom 20.04.2024 | ||

|
Afrikanische Frauen |
|
| Bewertung vom 19.03.2024 | ||
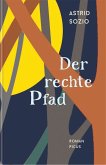
|
Ja - aber … |
|
