BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 785 Bewertungen| Bewertung vom 06.05.2023 | ||

|
informatives Heftchen |
|
| Bewertung vom 03.05.2023 | ||

|
Atlas der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften in Deutschland Bis in die kleinste Gemeinschaft |
|
| Bewertung vom 16.04.2023 | ||
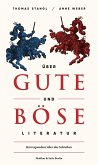
|
langweiliger Briefwechsel |
|
| Bewertung vom 16.04.2023 | ||

|
"Katholisch und deutsch" - Die alt-katholische Kirche Deutschlands und der Nationalsozialismus Die Nazizeit in der Altkatholischen Kirche |
|
| Bewertung vom 06.04.2023 | ||
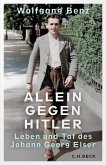
|
Bewegende Widerstandsbiografie |
|
| Bewertung vom 03.04.2023 | ||
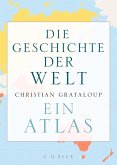
|
neuer historischer Atlas |
|
| Bewertung vom 02.04.2023 | ||

|
Licht und Schatten |
|
| Bewertung vom 01.04.2023 | ||
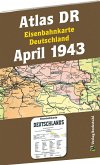
|
ATLAS DR April 1943 - Eisenbahnkarte Deutschland Eisenbahnherz, was willst du mehr! |
|
| Bewertung vom 01.04.2023 | ||
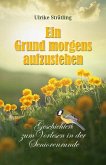
|
Heiteres für den April |
|
| Bewertung vom 31.03.2023 | ||
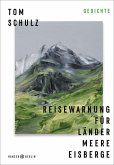
|
Reisewarnung für Länder Meere Eisberge Nur ein guter Titel |
|
