BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 544 Bewertungen| Bewertung vom 12.04.2021 | ||

|
Da ich ein großer Freund von Regio-Krimis bin und mir die Gegend zwischen Roetgen und Mausbach, das Hohe Venn und die (Vor)Eifel nicht unbekannt sind, habe ich mich auf „Die Akte Hürtgenwald“ von Lutz Kreutzer sehr gefreut. Völlig enttäuscht wurde ich von dem Buch nicht, aber wirklich begeistern konnte es mich weder inhaltlich noch sprachlich. Die Schlacht im Hürtgenwald vermutlich vielen bekannt, die Deutsche Wehrmacht stellte sich gegen den Vormarsch der amerikanischen Truppen. Die „Altlasten“ aus der Zeit sind trotz der Wiederaufforstung an manchen Stellen noch deutlich zu erkennen, auch einige Bunker existieren noch. Bis in die 2000er-Jahre wurden in der Gegend noch Überreste von gefallenen Soldaten gefunden. |
|
| Bewertung vom 12.04.2021 | ||
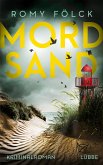
|
Mordsand / Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn Bd.4 „Mordsand“ ist der vierte Band aus Romy Fölcks Serie um das Ermittlerduo Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn. Natürlich ist das Buch eigenständig zu lesen, Vorkenntnisse aus den anderen Teilen sind hilfreich, aber man braucht sie für das Verständnis nicht zwingend. Da diese aber ebenso spannend und unterhaltsam sind, ist die Lektüre durchaus empfehlenswert. |
|
| Bewertung vom 01.04.2021 | ||

|
Tja, da hat sich Friedrich mit seiner Faulheit ja etwas eingebrockt. Statt mit der Familie in den Urlaub zu fahren, darf er seine Sommerferien damit verbringen, sich bei den Großeltern auf die Nachprüfung vorzubereiten. Denn mit den Fünfen in Latein und Mathe wird er nicht versetzt und ein zweites Mal darf er die neunte Klasse nicht wiederholen. Da ist Pauken angesagt, denn der Großvater (eigentlich Stief-Großvater) ist streng, gebildet und konsequent. Die Großmutter ist Künstlerin, liebevoll und warmherzig – was für ein Kontrast. Friedrich erlebt einen ganz besonderen Sommer, in dem er viel lernt. Natürlich Mathe und Latein, aber auch über das Leben, Liebe, Freundschaften und nicht zuletzt über sich selbst und dass manches und mancher anders ist, als er bislang geglaubt hat. |
|
| Bewertung vom 24.03.2021 | ||
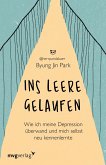
|
„Ich, depressiv? Niemals!“ – so dachte Byung Jin Park noch vor einigen Jahren. Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, kurzer Geduldsfaden – ja, aber das liegt ja an etwas anderem. Dass er im zwei-Wochen-Rhythmus krank wurde hatte auch einen anderen Grund. Welchen? Das wusste er auch nicht so genau. Aber irgendwann konnte er sich vor der Diagnose nicht mehr verstecken. Der Anwalt musste sich der Wahrheit stellen: er leidet unter einer Depression. Wie er es geschafft hat, damit leben zu lernen, beschreibt der inzwischen 36-Jährige in seinem Buch „Ins Leere gelaufen“. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||
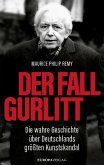
|
„Der Fall Gurlitt. Die wahre Geschichte über Deutschlands größten Kunstskandal“ von Maurice Philip Remy ist ein Buch, das mich in mehrerlei Hinsicht fassungslos zurückgelassen hat. Es ist für mich nicht nur ein Buch über einen „Kunstskandal“, sondern ein Buch über viel mannigfaltigere Skandale. Denn es umfasst neben dem „Skandal“ der gefundenen Kunstwerke auch skandalös unsaubere Ermittlungsarbeit von Polizei und Zoll, skandalös unseriöse Politiker und skandalös unethische Pressearbeit. Der Autor entwirrt auf über 400 Seiten (plus mehr als 100 Seiten Quellenangaben) minutiös die Fäden, die bei Cornelius Gurlitt 2013 zusammengelaufen sind, in dem Jahr, als der Focus „Der Nazi-Schatz“ titelte und herausposaunte, dass in Gurlitts Münchner Wohnung 1500 Beutekunst-Stücke gefunden worden wären. Heute würde man das „Fake News“ nennen. |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||

|
Guter Einblick |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||
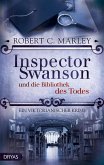
|
Inspector Swanson und die Bibliothek des Todes „Inspector Swanson und die Bibliothek des Todes“ von Robert C. Marley ist ein Buch, das mich sehr zwiegespalten zurücklässt. Einerseits hat der Autor die Atmosphäre der ehrwürdigen Bodleian Library (Bibliothek der Universitäten von Oxford) sehr gut eingefangen, das Viktorianische England des Jahres 1895 ist auch greifbar gut beschrieben, ich bin ein großer Fan von Oscar Wilde (um den sollte es schließlich auch gehen) und dennoch konnte mich das Buch als Krimi nicht begeistern. |
|
| Bewertung vom 16.03.2021 | ||
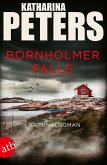
|
Bornholmer Falle / Sarah Pirohl ermittelt Bd.2 Innerhalb von nur vier Wochen hat Katharina Peters mit „Bornholmer Falle“ schon den zweiten Krimi dieses Jahres veröffentlicht. Respekt! Leidet die Qualität mit der Geschwindigkeit, in der sie „liefert“? Mitnichten! Auch Bornholmer Falle war für mich ein spannender und gut geschriebener Thriller. Zwar brauchte die Geschichte für mich ein wenig Zeit, um in Fahrt zu kommen, dann packte sie mich aber und der Schluss, ein mega Cliffhanger, ließ die Spannung fast ins Unermessliche steigen. Jetzt heißt es auf den nächsten Teil der Reihe warten. |
|
| Bewertung vom 02.03.2021 | ||
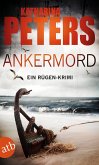
|
Ankermord / Romy Beccare Bd.10 (eBook, ePUB) Zwei Arbeiter entdecken an der Binzer Seebrücke eher zufällig eine männliche Leiche, die mit einer Ankerkette an einem Pfeiler unter Wasser angekettet wurde. Hauptkommissarin Romy Beccare steht vor einem Rätsel. Erst als die Identität des Toten geklärt ist, kommt sie einen kleinen Schritt weiter, die Ermittlungen erweisen sich aber als vielschichtig und enorm aufwändig. Denn Marek Liberth ist selbst kein unbeschriebenes Blatt, er ist wegen kleinerer Drogendelikte vorbestraft und von seinem letzten Arbeitgeber, einer Zuliefererfirma für Werften, entlassen worden. Auch zu seiner Kindheit im Heim könnte eine Spur auf der Suche nach dem Mörder führen. Haupt-Augenmerk der Ermittler liegt allerdings auf der Firma, bei der Liberth gearbeitet hat, denn auch die Chefin scheint einiges zu verbergen. |
|
| Bewertung vom 01.03.2021 | ||
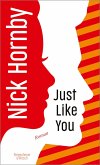
|
Über 20 Jahre nach „About a boy“ war es für mich mal wieder an der Zeit für ein Buch von Nick Hornby. Und da ich die Brexit-Verhandlungen gespannt verfolgt habe, fand ich sein neuestes Werk „Just like you“ interessant, verspricht es doch laut Klappentext „Liebe in Zeiten des Brexit“. Und tatsächlich schafft das Buch es auf sehr spannende Weise, beides zu verknüpfen. Und eines ist schon von Anfang an klar: kompliziert wird beides. |
|
