BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 962 Bewertungen| Bewertung vom 14.04.2021 | ||

|
Fanal der Selbstbehauptung |
|
| Bewertung vom 12.04.2021 | ||

|
Alles eine Frage der Sprache |
|
| Bewertung vom 08.04.2021 | ||

|
Die französische Kunst des Krieges Illusionistische Multikulti-Euphorie |
|
| Bewertung vom 02.04.2021 | ||

|
Desavouierendes Hohngelächter |
|
| Bewertung vom 31.03.2021 | ||
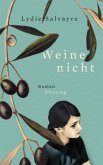
|
Holzschnittartige Erzählweise |
|
| Bewertung vom 28.03.2021 | ||

|
DAVE - Österreichischer Buchpreis 2021 Alles völlig sinnfrei 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.03.2021 | ||
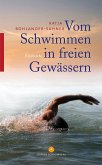
|
Vom Schwimmen in freien Gewässern Wie das Leben halt so spielt 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.03.2021 | ||

|
Keine einfachen Wahrheiten |
|
| Bewertung vom 21.03.2021 | ||

|
Sic transit gloria mundi |
|
| Bewertung vom 18.03.2021 | ||
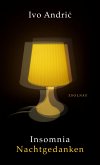
|
Vom Bruder des Todes |
|
