BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 785 Bewertungen| Bewertung vom 07.02.2023 | ||

|
Aus der Zeit gefallen |
|
| Bewertung vom 06.02.2023 | ||
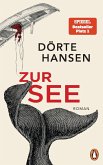
|
Nordseebuch 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 17.01.2023 | ||

|
Landflucht literarisch behandelt |
|
| Bewertung vom 16.01.2023 | ||

|
überraschende Wendungen |
|
| Bewertung vom 14.01.2023 | ||
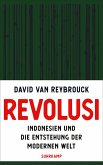
|
Wie Indonesien ein souveräner Stadt wurde 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 07.01.2023 | ||
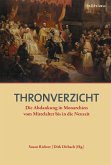
|
passendes Sachbuch zum Titel |
|
| Bewertung vom 06.01.2023 | ||
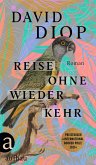
|
Reise ohne Wiederkehr oder Die geheimen Hefte des Michel Adanson starke N-Wort Liebe |
|
| Bewertung vom 31.12.2022 | ||
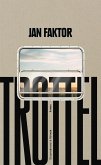
|
die Niete des Buchpreises |
|
| Bewertung vom 23.12.2022 | ||

|
Skizzen eines Dorfes |
|
| Bewertung vom 18.12.2022 | ||

|
Historische Biografie |
|
