BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 776 Bewertungen| Bewertung vom 10.05.2018 | ||

|
Einsteins Ideen - Das Relativitätsprinzip und seine historischen Wurzeln Der Physiker Banesh Hoffmann war in den 1930er Jahren wissenschaftlicher Assistent bei Albert Einstein. Zusammen mit Einstein und Infeld entwickelte er die Einstein-Infeld-Hoffmann-Bewegungsgleichung, eine Differentialgleichung, die relativistische Effekte berücksichtigt. Damit ist er ein Zeitzeuge aus dem unmittelbaren Umfeld von Einstein und kompetent, "Einsteins Ideen" zu Raum und Zeit vorzustellen. Es ist kein Fachbuch, aber erklärungsmächtiger als rein populärwissenschaftliche Darstellungen. |
|
| Bewertung vom 05.05.2018 | ||

|
Albert Einstein relativierte Raum und Zeit. Er entdeckte, dass die reale Welt nicht mit der Ordnung unserer Denkstrukturen übereinstimmt. Darin liegt die zentrale Bedeutung der Relativitätstheorie und aus diesem Grund wird sie zurecht als kopernikanische Tat angesehen. Was ist das für eine Theorie? Wer ist der Mensch hinter dieser Theorie? |
|
| Bewertung vom 01.05.2018 | ||

|
Eine kurze Geschichte der Zeit „Eine kurze Geschichte der Zeit“ ist das erste populärwissenschaftliche Buch von Stephen Hawking. Damit erhalten die Leser nicht nur einen kompetenten Überblick über Theorien der Kosmologie, sondern auch Einblick in das Denken des Autors. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 28.04.2018 | ||
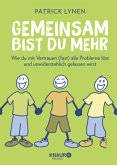
|
„Love is the answer“ [1] 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.04.2018 | ||
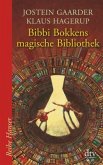
|
Bibbi Bokkens magische Bibliothek Berit Bøyum aus Fjærland und ihr Vetter Nils Bøyum Torgersen aus dem 350 km entfernt liegendem Oslo schreiben ein Briefbuch, welches sie sich abwechselnd gegenseitig zuschicken und ergänzen. Das ist für Buchfreunde eine geniale Idee, wenngleich der Gedankenaustausch heute – also 25 Jahre nach Erscheinen der Originalausgabe – digital erfolgen würde. Aber auch aus digitalen Daten lässt sich ein Buch drucken. |
|
| Bewertung vom 05.04.2018 | ||
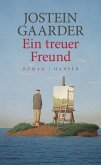
|
„Und warum bin ich [Jakop] dermaßen besessen von sprachlichen Verwandtschaftsbeziehungen? … Ich habe keine andere Großfamilie, mit der ich mich auseinandersetzen könnte, als die indogermanische Sprachfamilie.“ (183) In dieser Aussage kommen Situation, Interessen und Eigenarten von Protagonist Jakop prägnant zum Ausdruck. Seine Leidenschaft für sprachliche Strukturen und Beziehungen überträgt er wie selbstverständlich auch auf menschliche Verwandtschaftverhältnisse. |
|
| Bewertung vom 04.04.2018 | ||

|
Stoizismus beschreibt eine (nicht nur) praktische Philosophie, die ihren Ursprung im alten Griechenland (Zenon aus Kition) hat und von den Römern (Seneca, Epiktet, Aurelius) adaptiert wurde. Sie propagiert ein tugendhaftes Leben in Übereinstimmung mit der Natur und der Vernunft. „Ideen sind Werkzeuge, die Menschen entwickelt haben, um Probleme des Daseins zu lösen.“ (151) Svend Brinkmann greift bestimmte Aspekte des Stoizismus auf, um damit auf Herausforderungen der Neuzeit zu reagieren. |
|
| Bewertung vom 31.03.2018 | ||
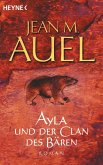
|
Ayla und der Clan des Bären / Ayla Bd.1 Der Neandertaler (Homo neanderthalensis) ist vor ca. 30.000 Jahren ausgestorben. Durchgesetzt hat sich der moderne Mensch (Homo sapiens). Er ist der einzige Überlebende der Gattung Homo. Archäologische Funde weisen daraufhin, dass Neandertaler und unser Vorfahr bis vor 30.000 Jahren gleichzeitig auf der Erde gelebt haben. Untersuchungen des Genoms lassen vermuten, dass es Verbindungen zwischen Neandertaler und modernem Menschen gab. Von einem solchen Zusammentreffen handelt der Roman. |
|
| Bewertung vom 25.03.2018 | ||

|
Der Ich-Erzähler und Protagonist der Erzählung, ein Drehbuchautor, fährt Anfang Dezember für fünf Tage mit seiner Frau Susanna und seiner vierjährigen Tochter Esther zu einem einsamen Ferienhaus in den Bergen. Soweit die Fakten. Alles was darüber hinaus passiert ist – wie das Haus selbst – perspektivisch verzerrt bzw. entspringt den Wahnvorstellungen des Ich-Erzählers. |
|
| Bewertung vom 24.03.2018 | ||
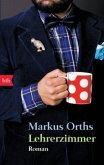
|
Eine schwarze Satire auf den Schulbetrieb |
|
