BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 785 Bewertungen| Bewertung vom 19.07.2022 | ||

|
politisches Tagebuch |
|
| Bewertung vom 12.07.2022 | ||
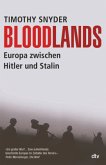
|
Terror in Osteuropa |
|
| Bewertung vom 11.07.2022 | ||
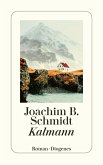
|
Der Münster-Tatort in Island |
|
| Bewertung vom 01.07.2022 | ||
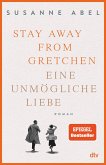
|
Stay away from Gretchen / Gretchen Bd.1 Rassismus im Nachkriegsdeutschland 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 24.06.2022 | ||

|
Wie ein deutscher Professor ein Buch schreibt |
|
| Bewertung vom 21.06.2022 | ||
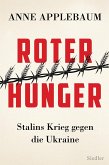
|
Stalins Terror |
|
| Bewertung vom 18.06.2022 | ||
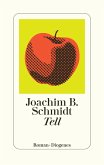
|
Überraschende Neuerzählung |
|
| Bewertung vom 14.06.2022 | ||
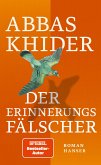
|
gutes Sommerbuch |
|
| Bewertung vom 06.06.2022 | ||
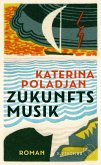
|
Pfingstsonntagbeschäftigung |
|
| Bewertung vom 05.06.2022 | ||

|
Fehlende Spannung |
|
