BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 962 Bewertungen| Bewertung vom 30.07.2020 | ||

|
Bereichernd und erfreulich? |
|
| Bewertung vom 27.07.2020 | ||

|
Ein Glücksfall der Gegenwartsliteratur |
|
| Bewertung vom 24.07.2020 | ||
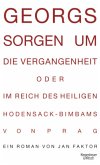
|
Georgs Sorgen um die Vergangenheit Éducation sentimentale |
|
| Bewertung vom 18.07.2020 | ||

|
Selbstgefälliges Palaver |
|
| Bewertung vom 16.07.2020 | ||
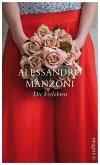
|
Faktenbasierte Horizonterweiterung |
|
| Bewertung vom 07.07.2020 | ||
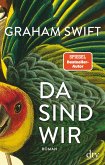
|
Rhetorische Floskel |
|
| Bewertung vom 30.06.2020 | ||
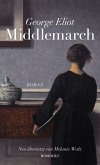
|
Der Weg ist das Ziel 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.06.2020 | ||
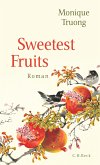
|
Heimatloser Literat |
|
| Bewertung vom 25.06.2020 | ||

|
Der Russe ist einer, der Birken liebt Seelisches Chaos |
|
