BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 206 Bewertungen| Bewertung vom 30.10.2024 | ||

|
Pegau in Sachsen, 1681: Der renommierte Arzt Dr. Johannes Schreyer ist eigentlich auf dem Weg zur Leipziger Messe, als er vom Amtmann Abraham Walther beauftragt wird, den Leichnam eines neugeborenen Säuglings zu begutachten. Die 15-jährige Anna Voigt wird verdächtigt, ihre kleine Tochter gleich nach der Geburt getötet zu haben. Die Stichwunden am Körper des Babys sprechen Bände, doch um auf Nummer sicher zu gehen, legt Schreyer ein Teilchen der Lunge in einen Behälter mit Wasser. Als die Lunge sinkt und nicht oben schwimmt, ist für Schreyer klar: Das Kind hat nie geatmet und war bei der Geburt folglich schon tot. Vorhang auf für die Lungenschwimmprobe - und damit für den neuen Roman des Norwegers Tore Renberg, der in der deutschen Übersetzung von Karoline Hippe und Ina Kronenberger bei Luchterhand erschienen ist. |
|
| Bewertung vom 20.10.2024 | ||

|
Eine ganz gewöhnliche Fliege und andere heitere Erzählungen Eine Fliege, die sich weigert das Arbeitszimmer zu verlassen. Eine ziellose Zugfahrt durch Schweden, die immer teurer wird. Oder ein Straßenbahnschaffner in Chicago, der von einem Fahrgast ein merkwürdiges Angebot erhält. So unterschiedlich und vielfältig präsentiert sich der spätere Literaturnobelpreisträger Knut Hamsun in seinen frühen heiteren Erzählungen, die bei Reclam erschienen sind und von der renommierten Übersetzerin und Autorin Gabriele Haefs herausgegeben und mit einem Nachwort versehen wurden. Laut Klappentext zeige sich Hamsun in ihnen, "wie man ihn bisher noch nicht kannte: heiter, komisch, grotesk", was allerdings nur halbwegs stimmt. Denn diese Seite des Norwegers findet man auch in seinem Erfolgsroman "Hunger" an mehreren Stellen überdeutlich, was nicht nur Astrid Lindgren bemerkte. Überraschend ist vielmehr, wie unterschiedlich dieser Humor, diese heitere Seite in den Geschichten hervortritt, was aus dem Erzählband ein wunderbares Dokument der frühen Hamsun-Schaffensphase macht. |
|
| Bewertung vom 10.10.2024 | ||
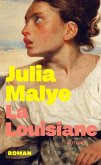
|
Paris, 1720. Marguérite muss sich entscheiden. 92 Frauennamen muss die Leiterin des Hospitals La Salpêtrière auf die Liste schreiben, die über das weitere Schicksal ihrer Schützlinge bestimmt. Hier, in diesem Sammelbecken von Waisenkindern, Gefangenen, psychisch Kranken und weiteren gesellschaftlichen Außenseiterinnen. 92 Frauen, "Freiwillige", die in Kürze eine mehrmonatige Reise über den Ozean antreten müssen. Ihr Ziel: die französische Kolonie La Louisiane, deren Fortbestand aufgrund fehlenden Nachwuchses ansonsten nicht gewährleistet wäre... |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||

|
Etwa mit sieben Jahren beginnt es. Neiges Stiefvater nähert sich ihr in der Nacht oder wenn die Mutter nicht im Hause ist. Er wird es immer wieder tun, über Jahre hinweg, bis in die Pubertät hinein. Ein Stiefvater und Vergewaltiger. Wie lebt ein Kind, das sich einer solchen Gewalt ausgesetzt sieht? Wie überlebt es? Und wie kann man den Menschen davon erzählen, dem eigenen Umfeld, aber auch der ganzen Welt? Mit einem Buch wie "Trauriger Tiger" von Neige Sinno, das in der Übersetzung aus dem Französischen von Michaela Meßner bei dtv erschienen ist. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 30.09.2024 | ||
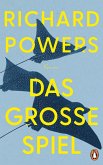
|
Irgendwann im Jahr 2027: Die Menschen auf Makatea, einer kleinen Pazifikinsel, müssen sich entscheiden: Aus den USA gibt es das Angebot, aus dem verschlafenen Eiland eine Gesellschaft der Zukunft zu machen, eine schwimmende Stadt mit hochmodernem Hafen. Hoffnungen und Zweifel halten sich die Waage. Unter den Unentschlossenen befinden sich auch die über 90-jährige Meeresforscherin Evie Beaulieu, Künstlerin Ina Aroita und ihr Mann, der Literaturfreund Rafi Young, den einst eine tiefe Freundschaft mit dem mittlerweile steinreichen IT-Nerd Todd Keane verband. Währenddessen erinnert sich der demenzkranke Keane in den USA an diese Freundschaft und ihre Anfänge. Was hat die beiden Sonderlinge einst nur auseinandergebracht? 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.09.2024 | ||
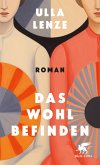
|
Beelitz, 2020: Als sich Vanessa die luxuriös sanierte Wohnung im ehemaligen Postgebäude der Beelitzer Heilstätten anschaut, weiß sie sofort, dass sie sich diese nicht leisten kann. Knapp 400.000 Euro für 66 Quadratmeter, wer soll das vom Makler angepriesene "Schnäppchen" bloß bezahlen? Doch sie braucht dringend eine Wohnung, weil ihr der Vermieter wegen Eigenbedarfs in zentraler Berliner Lage einfach gekündigt hat. Noch ahnt sie nicht, dass die Begegnung mit dem Makler und die Besichtigung der Heilstätten ihrem Leben eine ungeahnte Wende geben sollen. Denn an diesem Ort recherchierte einst Vanessas Urgroßmutter Johanna für ihren Anfang des 20. Jahrhunderts erschienenen Erfolgsroman "Das Schmuckzimmer". Und es ist ausgerechnet der Makler Maurus, dem ein bislang unveröffentlichtes Manuskript Johannas vorliegt... |
|
| Bewertung vom 16.09.2024 | ||
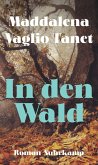
|
Als die Lehrerin Silvia aus der Tageszeitung vom Tod ihrer elfjährigen Schülerin Giovanna erfährt, gibt es für sie nur eine Entscheidung: Sie kann jetzt nicht in die Schule gehen, sondern sucht Unterschlupf im Wald. Dort, wo sie selbst schon als kleines Mädchen mit ihrem Cousin Anselmo gespielt hat, jeden Baumstumpf kannte, jedes Tier. Sie fühlt sich schuldig, hatte sie doch noch kurz zuvor einen Anruf bei der Mutter Giovannas getätigt. Wie lebt es sich mit diesen Schuldgefühlen? Und wie verschwindet man als Erwachsener eigentlich am besten, wenn man gar nicht gefunden werden möchte? Darüber und über so viel mehr schreibt Maddalena Vaglio Tanet in ihrem Debütroman "In den Wald", der in Italien für den Premio Strega nominiert war und in der Übersetzung aus dem Italienischen von Annette Kopetzki bei Suhrkamp erschienen ist. |
|
| Bewertung vom 16.09.2024 | ||

|
Die 13-jährige Pilly wächst Anfang der 1990er-Jahre irgendwo in der Nähe von Magdeburg im ehemaligen Elbe-Grenzgebiet auf. Die DDR spukt den Menschen noch in den Köpfen herum, während Industriebauten brach liegen und Investoren aus dem Westen schon bereitstehen. Wie soll man da erwachsen werden, wenn die Mutter verschwunden ist und der Vater ein passionierter Trinker? Als Pilly Anschluss an die etwas älteren Freundinnen Katja und Bine findet, spürt sie endlich so etwas wie Nähe. Gerade bei Katja fühlt sie sich geborgen. Aber wird das Mädchen die Gefühle erwidern? |
|
| Bewertung vom 09.09.2024 | ||

|
Das Haus in dem Gudelia stirbt Als die 81-jährige Gudelia aus dem Fenster ihres Hauses im fiktiven Unterlingen schaut, traut sie ihren Augen kaum. Tote Schweine schwimmen vorbei, zerstörte Autos – und waren das gerade nicht zwei menschliche Leichen? Die Flut hat Unterlingen mit voller Wucht getroffen. Längst haben Gudelias Nachbar:innen den Ort verlassen. Doch Gudelia bleibt. Denn in ihrem Haus schlummert ein dunkles Geheimnis… |
|
| Bewertung vom 09.09.2024 | ||
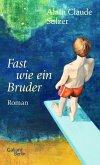
|
Im Bochum der 1960er- und 1970er-Jahre wachsen Frank und der namenlose Ich-Erzähler fast wie Brüder zusammen auf. Beide sind sogar am selben Tag mit ihren Familien in die direkt nebeneinander liegenden Wohnungen eingezogen. Doch als Franks Interesse an der Kunst wächst und er homosexuelle Gefühle für den Nachbarsjungen Matteo verspürt, scheinen sich die Freunde unterschiedlich zu entwickeln. Erst als Frank mit AIDS im Sterbebett liegt, finden sie wieder zueinander. Und auch Franks Gemälde wecken lange Zeit nach dessen Tod plötzlich das Interesse des Ich-Erzählers. Denn stellt der nackte Jüngling auf einem Bild von Frank nicht ihn selbst da? |
|
