BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 214 Bewertungen| Bewertung vom 05.10.2025 | ||

|
Bei Royal Kopenhagen denkt man wohl zuerst an Porzellan und übersieht leicht, dass auch in der Steinzeugabteilung unter Nils Thorsson über fast 40 Jahre Herausragendes geleistet wurde. Anders als sein Vorgänger Hans Madslund, der als Chemiker mit reinen Ausgangsmaterialien experimentierte, stützte Thorsson seine Glasurrezepte mehr auf naturnahe Grundmaterialien, wie z. B. rohes Eisenerz. Die Vorbilder waren Typen der ostasiatischen Keramik, z. B. chinesische Seladonglasuren oder die expressiven Temmoku-Glasuren Japans. |
|
| Bewertung vom 04.10.2025 | ||
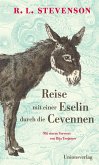
|
Reise mit einer Eselin durch die Cevennen Robert Louis Stevenson war gerade einmal 27 Jahre alt, als er mit einem Esel per pedes durch die Cevennen zog. Das war im Jahr 1878 und seine Tagebuchaufzeichnungen, die er ein Jahr darauf publizierte, gehören zu den absoluten Klassikern der Reiseliteratur. Die Auswirkungen reichen bis in die Gegenwart, denn auch heute noch kann man in den Cevennen aus einem reichhaltigen Angebot von Eselverleihern wählen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.10.2025 | ||

|
DUMONT Reise-Handbuch Reiseführer Japan Japan ist im Moment in, leider muss man fast schon sagen, denn der Übertourismus wütet hier besonders schlimm. Umso wichtiger ist es, gut informiert ins Land zu reisen, damit man ggf. ausweichen kann. Françoise Hauser macht in ihrem Reiseführer als eine der wenigen Reisebuchautoren tatsächlich auf das Problem aufmerksam und weist auf besonders belastete Ziele hin. Sie sucht neben den Höhepunkten, die natürlich nicht fehlen dürfen, auch nach interessanten Alternativen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 02.10.2025 | ||
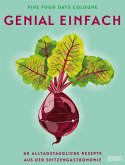
|
„Spitzengastronomie“ klingt zuerst mal nach viel Schischi, aber ich wurde angenehm überrascht. Kaum etwas in diesem Rezeptbuch ist wirklich kompliziert, die Zutaten sind leicht erhältlich und meist auch bezahlbar. Die Food-Stylisten haben ebenfalls ganze Arbeit geleistet, die Präsentation hat Sterneküche-Niveau. Ich denke, das ist auch eine Form des Respekts vor den Lebensmitteln (oder vor dem „Produkt“, wie der Schischi-Koch sagt) und ein schöner Teller ist immer auch ein Kunstwerk. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 28.09.2025 | ||
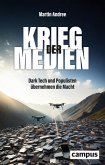
|
In „Krieg der Medien“ beschreibt Martin Andree, wie große Tech-Konzerne, libertäre Denker und rechtspopulistische Politiker gemeinsam die Kontrolle über die digitale Öffentlichkeit übernehmen. Diese Akteure nutzen das Versprechen unbegrenzter Meinungsfreiheit, um demokratische Regeln zu umgehen und gezielt Desinformation zu verbreiten. Der Libertarismus dient dabei als ideologisches Fundament, das jede Form von Regulierung als Zensur darstellt. Besonders die USA fördern diese Entwicklung durch ein Haftungsprivileg, das Plattformen von Verantwortung für Inhalte befreit, während die EU mit schwacher Regulierung kaum gegensteuert. |
|
| Bewertung vom 14.09.2025 | ||

|
KI im Requirements Engineering Die Komplexität moderner IT-Systeme nimmt stetig zu, während gleichzeitig die Entwicklungszyklen immer kürzer werden. Diese Beschleunigung geht nicht selten mit einer erhöhten Fehleranfälligkeit einher. Die Ursachen für das Scheitern von Entwicklungsprojekten sind vielfältig – ein zentraler Faktor liegt jedoch in unklaren Zieldefinitionen sowie in fehlenden, fehlerhaften oder sich häufig ändernden Anforderungen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit Künstliche Intelligenz einen Beitrag zur Verbesserung des Anforderungsmanagements leisten kann. Genau hier setzt das Buch „KI im Requirements Engineering“ von Die SOPHISTEN an und bietet einen praxisorientierten Einstieg in den Einsatz von KI-Technologien in diesem Bereich. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 13.09.2025 | ||
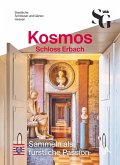
|
Schloss Erbach ist heute in erster Linie bekannt als Sitz des Deutschen Elfenbeinmuseums, war die Stadt Erbach doch bis ins 20. Jahrhundert hinein ein weltweit führendes Zentrum der Elfenbeinschnitzerei. Die unternehmerischen Grundlagen dieses erfolgreichen „Industriezweiges“ schuf Graf Franz I. zu Erbach-Erbach, ein im besten Sinne aufgeklärter Herrscher des 18. Jahrhunderts, der selber das fürstliche Hobby der Elfenbeindrechselei betrieb. Franz sammelte auch mit Leidenschaft - nicht etwa Elfenbein, sondern Antiken, asiatisches Porzellan, Rüstungen, Waffen, ethnologische und zoologische Exponate, worunter die (nicht jagdliche!) Geweihsammlung wohl das Kurioseste ist. Mit für seine Zeit großer Sachkunde trug er zu einigen Themen enzyklopädische Kollektionen zusammen, die er in opulent ausgestatteten Katalogen dokumentierte und bearbeitete. Seit 2005 ist Schloss Erbach inklusive der erhaltenen gräflichen Sammlung in staatlichem Besitz und gehört zu den bedeutenden nationalen Kulturgütern Hessens. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 01.09.2025 | ||

|
Sam Altman ist die zentrale Figur hinter OpenAI. Doch wer steckt wirklich hinter dem erfolgreichen Unternehmer und Investor? Die Journalistin Keach Hagey wollte genau das herausfinden und hat dafür zahlreiche Gespräche geführt – nicht nur mit Altman selbst, sondern auch mit seiner Familie, engen Freunden, Wegbegleitern und Geschäftspartnern. Aus diesen intensiven Recherchen entstand die aufschlussreiche und lesenswerte Biografie mit dem Titel „Sam Altman: OpenAI, Künstliche Intelligenz und der Wettlauf um unsere Zukunft“. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 15.08.2025 | ||
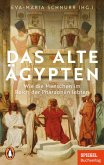
|
Als ich das Vorwort las, bekam ich ein sehr ungutes Gefühl: Alles sauber durchgegendert, schön unästhetisch mit Gender-Sternchen, triefend vor wokem Aktionismus und die moralische Keule bereits im Niedersausen: Europa böse, Ägypten guuuut. 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 06.08.2025 | ||

|
Das Methodensystem für Projekte Wer schon einmal ein Softwareprojekt geleitet hat weiß, es gibt unzählige Methoden, Werkzeuge und Konzepte. Einige sind sehr nützlich – andere weniger hilfreich. Manche erfordern viel Zeit und Aufwand, um sie zu verstehen und richtig anzuwenden. Dabei den Überblick zu gewinnen und zu behalten, ist eine echte Herausforderung. |
|
