BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 84 Bewertungen| Bewertung vom 29.07.2022 | ||
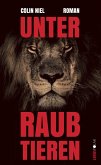
|
Modus vivendi. Modus operandi. |
|
| Bewertung vom 18.07.2022 | ||
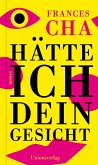
|
Weibliche Homunculi |
|
| Bewertung vom 28.06.2022 | ||

|
Die Brunnen der Vergangenheit |
|
| Bewertung vom 26.05.2022 | ||
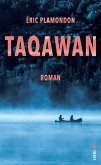
|
Der rote Faden-Verlauf oder Der Widerspenstigen Zähmung. |
|
| Bewertung vom 09.05.2022 | ||

|
Alles hängt mit allem zusammen. |
|
| Bewertung vom 24.03.2022 | ||

|
Quijote und Galileo reichen sich die Hände. |
|
| Bewertung vom 07.03.2022 | ||

|
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. (Adorno) 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 19.02.2022 | ||

|
Hortus conclusus oder Der alte Mann und das Meer |
|
| Bewertung vom 19.02.2022 | ||
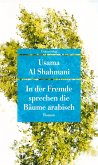
|
In der Fremde sprechen die Bäume arabisch Der mit den Bäumen spricht |
|
