BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 360 Bewertungen| Bewertung vom 02.09.2024 | ||
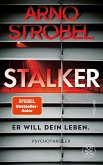
|
In seinem Psychothriller „Stalker“ spielt Arno Strobel erneut mit den Nerven seiner Leserschaft. Spannungsaufbauend erweitert er den Titel des Buchs mit „Er will dein Leben“, was heißt, dass ein anderer danach trachtet, die Identität des Protagonisten zu übernehmen. Die Geschichte beginnt eher ruhig und scheint aus dem alltäglichen Leben gegriffen. Doch sie enthält mehr Potential, als ein Blick durch die Jalousien eines Fensters ermöglichen würde, wie es versinnbildlichend auf dem Cover dargestellt ist. |
|
| Bewertung vom 01.09.2024 | ||
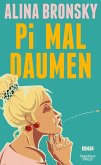
|
Für den Protagonisten Oscar des Romans „Pi mal Daumen“ von Alina Bronsky ist Mathematik keine Angelegenheit, bei der sich entsprechend der Redewendung des Buchtitels Ergebnisse nur ungefähr berechnen lassen. Das Zeichen für Pi, dass in der Mathematik für das Verhältnis vom Kreisumfang zu seinem Durchmesser steht, ähnelt dem von Doppelkirschen, weswegen auf dem Cover eine Frau für ebensolchen Kirschen als Ohrringe illustriert ist und einen Kirschkern ausspuckt. Diese Frau erinnerte mich beim Lesen an Moni Kosinsky, die im Roman ebenfalls eine tragende Rolle spielt. Der Zusammenhang zwischen dem Pi-Symbol und den Kirschen wird auch im Spruch „Come to the Math Side we have π“ deutlich, wobei das Zeichen wörtlich genommen und dem beliebtem Cherrypie (amerikanischer Kirschkuchen) gleichgesetzt wird. |
|
| Bewertung vom 25.08.2024 | ||
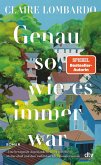
|
In ihrem Roman „Genau so, wie es immer war“ beschreibt Claire Lombardo nach ihrem Debüt „Der größte Spaß, den wir je hatten“ erneut ein familiäres Drama rund um ihre Protagonistin Julia Grace Ames, geborene Marini. Julia möchte am 60. Geburtstag ihres Ehemanns Mark eine Party veranstalten, wozu sie eine spezielle Zutat zum Dinner benötigt. Es hat für sie weitreichende Folgen, dass sie zu einem anderen Supermarkt fährt als dem üblichen, denn dort begegnet sie Helen, einer früheren Freundin. Das unerwartete Treffen löst bei Julia Erinnerungen aus an Ereignisse, die zwanzig Jahre und länger zurück in ihrer Vergangenheit liegen. |
|
| Bewertung vom 07.08.2024 | ||
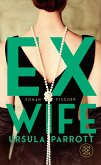
|
Es ist fast einhundert Jahre her, dass der Roman „Ex-Wife“ von Ursula Parrott zum ersten Mal veröffentlich wurde, jedoch kann man das beim Lesen häufig vergessen, denn die Handlung wirkt häufig so, als könnte sie in der Gegenwart spielen. Die Geschichte dreht sich um die 24-jährige Patricia, die nach vier Jahren Ehe von ihrem Mann Peter verlassen wird. |
|
| Bewertung vom 06.08.2024 | ||
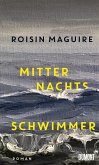
|
Die Protagonistin Grace des Romans „Mitternachtsschwimmer“ von Roisin Maguire ist genauso rau und sanft wie die See vor der Küste von Nordirland, an der der kleine Haupthandlungsort Ballybrady liegt. Das Dorf ist beschaulich und ähnelt dem, in dem die Autorin lebt, weswegen sie die dort vorherrschende Atmosphäre besonders gut eingefangen hat. Auch das Cover, das sehr schön vom Kölner Designbüro Lübbeke Naumann Thoben gestaltet wurde, strahlt die Unruhe und Stärke der See aus. Der Titel ist haptisch durch eine Tiefprägung im Papier spürbar und bezieht sich auf Grace, die es liebt, in der Nacht im Meer zu schwimmen und die Ruhe zu genießen. |
|
| Bewertung vom 01.08.2024 | ||
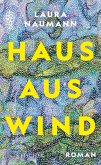
|
Wäre das Haus der Protagonistin Johanna aus Wind gebaut, dann könnte sie nichts umwerfen. Doch im entsprechend benannten Debütroman „Haus aus Wind“ von Laura Naumann ist das Leben von Johanna in Schräglage gekommen. Daher nimmt sie sich eine Auszeit und reist an die Algarve, um dort das Surfen zu lernen. 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 31.07.2024 | ||
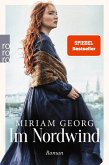
|
Im Nordwind / Nordwind-Saga Bd.1 Der Roman „Im Nordwind“ ist der erste Band einer Dilogie von Miriam Georg, die die Frauenrechte in der Hansestadt Hamburg in den 1910er Jahren ebenso wie Standesunterschiede in dieser Zeit thematisiert. Die Protagonistin Alice ist verheiratet und hat eine fünfjährige Tochter. Gemeinsam wohnen sie in einer kleinen Wohnung in einem zweiten Hinterhaus auf der Uhlenhorst. Einer alten Familienweisheit zufolge bringt Nordwind Ärger, was für Alice zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu werden scheint. |
|
| Bewertung vom 10.06.2024 | ||
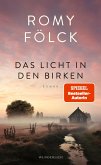
|
In ihrem Roman „Das Licht in den Birken“ erzählt Romy Fölck von einer Schicksalsgemeinschaft, die sich auf Bennos Gnadenhof für Tiere in der Lüneburger Heide zusammenfindet. Der Hof ist hoch verschuldet und deshalb hat Benno das ursprüngliche Kesselhaus renoviert und dort zwei Wohnungen eingerichtet. Thea hat eine davon gemietet. Sie ist Mitte Fünfzig und hat jahrelang eine der Herden Ziegen in Portugal gehütet, die präventiv Wälder reinigen und dadurch die Brandgefahr verringern. Kaum ist sie eingezogen, findet Benno beim Holzsammeln im nahegelegenen Forst Juli, eine junge verunfallte Frau, der er Unterkunft bietet, bis sie weiterwandern kann. |
|
| Bewertung vom 03.06.2024 | ||
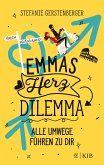
|
Die fast 16-jährige Emma empfindet ihr Leben als eintönig. Sie ist die Protagonistin des Jugendromans „Emmas Herzdilemma“ von Stefanie Gerstenberger. Gemeinsam mit ihren Eltern und einem Großvater wohnt sie in Köln-Lindenlauf. Manchmal hält sie sich nicht an die von Vater und Mutter aufgestellten Regeln. Als sie eine Woche vorm Sommerurlaub der Familie den Hund ihres Opas ausführt, kommt sie am Bode-Park vorbei, in dem der von ihr umschwärmte Oskar mit seinen Freunden Skatebord trainiert. In einem Moment ihrer Unaufmerksamkeit verunfallt der Hund. Emmas Eltern verlangen von ihr, dass sie die Tierarztkosten übernimmt, die sie in der Pension ihrer Tante in Italien erarbeiten soll. Kurz vor dem Abflug hat sie bei Gelegenheit die Fäden in der Hand, den weiteren Verlauf ihrer Ferien zu gestalten. |
|
| Bewertung vom 14.05.2024 | ||
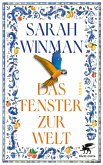
|
Im Roman „Das Fenster zur Welt“ beschreibt Sarah Winman die Freundschaft zwischen Private (=niedriger militärischer Rang) Ulysses Temper, einem in Zivil in London lebenden Globenbauer und Evelyn, einer Kunsthistorikerin, die über 60 Jahre alt ist und ebenfalls aus England stammt. Die beiden begegnen sich im Jahr 1944 in der Toskana, wo Evelyn darauf wartet, mit alliierten Kunstschutzoffizieren zusammenzuarbeiten und Ulysses um seine Mithilfe bittet. Wenig später nimmt er sie mit in einen Weinkeller, wo sie ihm bei Speis und Trank ihr Wissen um die Schönheit der italienischen Lebensart beschreibt und ihm damit seine Sicht aufs Leben weitet. |
|
