BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 764 Bewertungen| Bewertung vom 05.08.2016 | ||
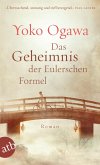
|
Das Geheimnis der Eulerschen Formel Eine einfühlsamer Roman aus Japan |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||

|
Das Wunder Mensch |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||
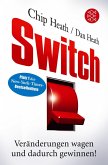
|
Yes we can |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||
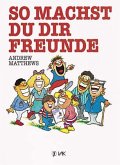
|
Nichts ändert sich, außer man selbst ändert sich |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||

|
Ein historisches Monumentalwerk 4 von 5 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||

|
Veränderte Wahrnehmungen |
|
| Bewertung vom 05.08.2016 | ||

|
Berthold Beitz - Die Biographie Der letzte Ruhrbaron 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.08.2016 | ||
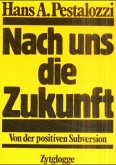
|
Widersprüche in unserer Gesellschaft |
|
| Bewertung vom 04.08.2016 | ||
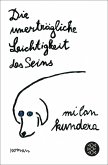
|
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Liebesgeschichten in Zeiten des Kalten Krieges |
|
| Bewertung vom 04.08.2016 | ||
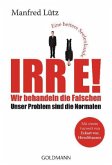
|
Irre! - Wir behandeln die Falschen Eine moderne Seelenkunde 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
