BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 245 Bewertungen| Bewertung vom 11.04.2025 | ||
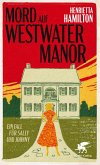
|
Mord auf Westwater Manor / Ein Fall für Sally und Johnny Bd.2 Dieser Krimi ist, wie sein Vorgängerband, nichts für Leser, die rasante Verfolgungsjagden und dramatische Show-downs lieben. Wir befinden uns wieder im Nachkriegsengland. Das Duo Sally und John ist inzwischen verheiratet und wird auf ein Landgut gebeten, um eine Bibliothek zu katalogisieren. Die Autorin entführt ihre Leser damit wieder in eine Umgebung, die man als typisch britisch empfindet: ein prächtiges Landhaus in einer malerischen Landschaft, umgeben von einem weitläufigen Park, der von mehreren Gärtnern in Ordnung gehalten wird. Und natürlich gibt es einen Butler und mehrere Bedienstete, damit sich die Bewohner nicht mit so trivialen Beschäftigungen wie Kochen, Bettenmachen und Staubwischen aufhalten müssen. |
|
| Bewertung vom 08.04.2025 | ||

|
Eine schöne Auswahl! |
|
| Bewertung vom 06.04.2025 | ||

|
Mein Hör-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 01.04.2025 | ||
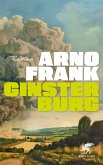
|
Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit kam in Deutschland nur zögerlich in Gang. Kaum zu glauben, dass erst jetzt eine Dissertation den Umgang des bayerischen Justizministeriums mit seinen belasteten Juristen ins Visier nimmt und ihn als „vergangenheitspolitische Fehlleistung“ und „Versagen“ bezeichnet. |
|
| Bewertung vom 27.03.2025 | ||

|
Anne Tylers Romane spielen immer im Alltäglichen. Sie nimmt nicht die großen Dinge der Welt ins Visier, sondern es sind die kleinen, alltäglichen Dinge und damit auch die eher alltäglichen Durchschnittsmenschen, die sie betrachtet. So ist es auch in diesem Roman. |
|
| Bewertung vom 22.03.2025 | ||

|
Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 20.03.2025 | ||
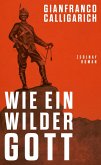
|
Die Erforschung des dunklen Kontinents durch die Europäer im 19.Jahrhundert – ein spannendes und vielschichtiges Thema! Die Forschungsreisen von Livingstone und Stanley bieten faszinierenden Lesestoff; der italienische Afrikaforscher Vittorio Bottego (1860 – 1897) dürfte dagegen wenig bekannt sein, und mit diesem Roman schließt der Autor eine Lücke. |
|
| Bewertung vom 03.02.2025 | ||
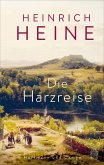
|
Mein Lese-Eindruck: |
|
| Bewertung vom 30.01.2025 | ||
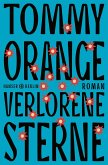
|
Manche Romane sind harter Tobak, und dieser Roman gehört dazu. Ausgangspunkt ist das Massaker von Sand Creek in Colorado, als im Spätherbst 1864 die U.S. Armee das Winterlager der Cheyenne und Arapaho überfiel und die Bewohner töteten, 2/3 davon Frauen und Kinder. Ein Junge kann sich retten und schließt sich mit dem indigenen Deserteur Red Feather zusammen. Über sieben Generationen und 150 Jahre hinweg bis in die Jetzt-Zeit verfolgt nun der Autor die Geschichte der Abkömmlinge dieser beiden „Indianer“, wie der Autor sie nennt. Und weil der Autor selber dem Stamm der Cheyenne und Arapaho angehört, ist es erlaubt, das Wort zu übernehmen. |
|
| Bewertung vom 22.01.2025 | ||
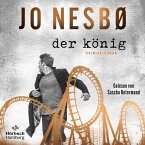
|
Mein Hör-Eindruck: |
|
