BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 132 Bewertungen| Bewertung vom 27.03.2025 | ||
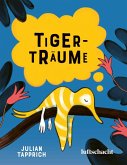
|
Der kleine, gelbe Vogel Leo ist anders - ihn langweilt der schlichte Vogelgesang seiner Artgenossen, denn das Träumen ist seine Leidenschaft: er möchte mit einer wilden Katze befreundet sein. Die Nachbarskatze jedoch hat nur das ihn-fressen im Sinn und so denk Leo groß: dann macht er sich halt einen Tiger zum Freund. |
|
| Bewertung vom 27.03.2025 | ||
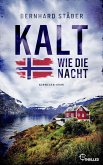
|
Kalt wie die Nacht (eBook, ePUB) Der "Wolf"-genannte Rolf Larsen braucht nach dem Tod seiner Frau Veränderung. So gibt er sein Polizisten-Dasein auf und zieht in das kleine Städtchen Bø, um sich als Privatdetektiv zu verdingen. Schnell kommt der erste Auftrag, doch aus einer einfachen Beschattung unter Mutmaßung einer Affäre wird schnell ein Mordfall. Gemeinsam mit der seltsamen Journalistin Sanna versucht er das, was der Polizei nicht so leicht gelingen mag: den Fall aufzuklären. |
|
| Bewertung vom 27.03.2025 | ||

|
Die jugendlichen Zwillinge Enna und Jale können es kaum erwarten: morgen wird ihre Mutter Alea nach jahrzehntelanger Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch als es soweit ist, sind sowohl Jale als auch Alea verschwunden und keiner weiß wohin. Zudem stirbt ein Mann bei einem Bootsunglück auf der Elbe und nicht nur die Polizei fragt sich, ob das alles etwas miteinander zu tun hat. Enna beginnt auf der Suche nach den vermissten Angehörigen ihre Familiengeschichte zu durchleuchten und immer mehr Geheimnisse geraten an die Oberfläche. |
|
| Bewertung vom 26.03.2025 | ||
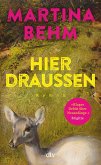
|
"Sich verabschieden von den Träumen vom Idyll, ankommen in einem echten Dorf, in dem die Dinge eben anders liefen als in den Köpfen von sechs Stadtmenschen, die hier etwas suchten, das es so eben doch nicht gab." (S. 196) |
|
| Bewertung vom 23.03.2025 | ||
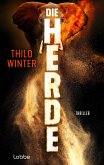
|
Der Zoologe Peter Danielsson reist nach China, um den Bau eines Riesenstaudamms zu verhindern, der nicht nur die Existenz weniger verbliebener Zwerggänse bedroht. Just zur selben Zeit wird bekannt, dass sich eine große Herde Elefanten aus einem chinesischen Nationalpark Richtung Norden auf den Weg gemacht hat und dabei Dörfer zerstört. Zeitgleich bedrohen in Bangkok Affen Menschen in einer Tempelanlage und in den USA bombardieren Millionen von Vögel einen Stadtteil mit ihrem Kot. Unterdessen weilt Peters Vater Abel in Mexiko und versucht die Geheimnisse der untergegangenen prähistorischen Stadt Teotihuacán auf die Spur zu kommen. Während Peter in China versucht, die Jagd auf die Elefantenherde zu verhindern, stellt sich nach und nach heraus, dass irgendwie alles miteinander zusammenhängt... |
|
| Bewertung vom 17.03.2025 | ||
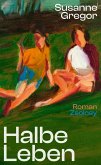
|
Klara ist tot. Abgestürzt beim Wandern. Ihre Begleiterin, Paulína - die Pflegerin von Klaras Mutter - kann dem nichts entgegensetzen. |
|
| Bewertung vom 16.03.2025 | ||
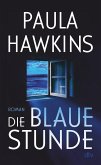
|
Vanessa Chapman war Künstlerin, die auf einer einsamen Insel lebte. Ihr Verhältnis zu Männern war problematisch, dafür wurden ihre Kunstwerke in der Szene umso mehr gefeiert. Jahre nach ihrem Tod stellt sich heraus, dass eines ihrer Werke einen menschlichen Knochen enthält. Der Kunstkurator James Becker begibt sich deshalb regelmäßig auf die Insel, um bei Vanessas Vertrauten Grace mehr über den Hintergrund des Kunstwerks und der Künstlerin herauszufinden. Dabei ist er einem dunklen Geheimnis auf der Spur... |
|
| Bewertung vom 12.03.2025 | ||

|
Die Mittelalterhistorikerin Racha Kirakosian nimmt uns in ihrem Buch "Berauscht der Sinne beraubt - Eine Geschichte der Esktase" mit in die Geschichte des (geistigen) Rauschzustands, indem sie die unterschiedlichen Wahrnehmungsstufen der Ekstase eingehend beleuchtet. |
|
| Bewertung vom 17.02.2025 | ||
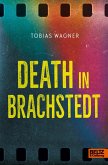
|
"Ein Wunder, dass nicht alles den Bach runtergeht, dachte ich, obwohl offensichtlich nur ein Bruchteil der Menschheit vollen Zugriff auf seinen Verstand hat." (S. 148) |
|
| Bewertung vom 14.02.2025 | ||
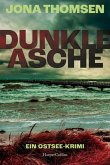
|
Die Polizeibeamtinnen Judith und Gudrun werden damit beauftragt, einen 30 Jahre zurückliegenden Mordfall an einer jungen Frau aufzuklären, nachdem es eine neue Zeugenaussage gibt. Alles sieht danach aus, als würde der ursprünglich Tatverdächtige nun endlich dingfest gemacht werden können. Doch dann tauchen neue Hinweise auf und Gudrun, die viele Beteiligte von damals kennt, muss gemeinsam mit Judith ein umfangreiches Lügennetz entwirren. |
|
