BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 765 Bewertungen| Bewertung vom 14.07.2016 | ||

|
„Ich setze meine Hoffnung auf die Ingenieure“ 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 14.07.2016 | ||
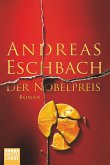
|
Gekaufter Ruhm |
|
| Bewertung vom 14.07.2016 | ||
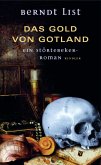
|
Freibeuter und „hanseatische Pfeffersäcke“ |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||
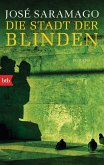
|
Wer schauen kann, der sehe |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||

|
Philosophische Wege zum Erleben der Welt |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||
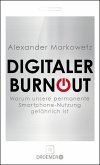
|
Smartphone Zombies - Schattenseiten der digitalen Welt |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||

|
Die Geschichte der Primzahlforschung |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||
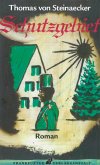
|
Glückssucher in Afrika |
|
| Bewertung vom 13.07.2016 | ||
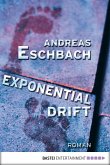
|
Exponentialdrift (eBook, ePUB) Ein literarisches Experiment 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 12.07.2016 | ||

|
Eine abenteuerliche Reise durch die Geschichte der Chirurgie |
|
