BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 84 Bewertungen| Bewertung vom 02.06.2021 | ||
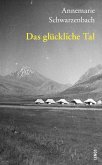
|
Elegie der Einsamkeit und der Freiheit 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.05.2021 | ||
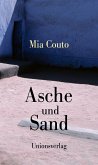
|
Ein lusitanisch-mozambikanisches Epos. "The Clash of Civilizations" |
|
| Bewertung vom 21.03.2021 | ||
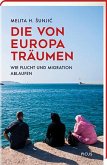
|
Ein feste Burg ist...??!! |
|
| Bewertung vom 02.03.2021 | ||

|
Sesam öffne Dich. |
|
| Bewertung vom 15.02.2021 | ||

|
Rue du pardon. Von Mahi Binebine. |
|
| Bewertung vom 07.01.2021 | ||

|
Vom großen Unglück und vom kleinen Glück, Vertreibung und Krieg, Heimat und Freundschaft. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 10.11.2020 | ||
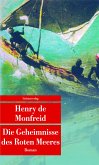
|
Die Geheimnisse des Roten Meeres Alles Schrifstellerleben sei Papier, heißt es. |
|
| Bewertung vom 10.11.2020 | ||

|
Ein Mensch, der spaziert, kann überhaupt nicht unglücklich sein. |
|
| Bewertung vom 10.11.2020 | ||
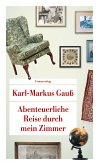
|
Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer Reisen en miniature: Pars pro toto. |
|
| Bewertung vom 09.11.2020 | ||

|
Der Fanatismus ist das tödliche Metronom, ohne dass die Wiegenlieder des Terrors nie erklängen. (Peter Rudl) |
|
