BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 544 Bewertungen| Bewertung vom 12.11.2024 | ||
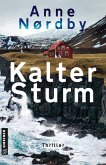
|
Mit „Kalter Sturm“ schickt Anne Nørdby ihren Ermittler Tom Skagen und seine Kollegen in ihren vierten Fall. Dieses Mal verschlägt es ihn eher unfreiwillig nach Island, wo er in vielerlei Hinsicht auf Neues und Unbekanntes stößt. Ein ruhiger, aber durchaus spannender Thriller mit viel Island, vielen Mythen und interessanten Charakteren. |
|
| Bewertung vom 05.11.2024 | ||
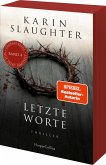
|
Ein mutmaßlicher Selbstmord, verschleppte Ermittlungen, ein echter Selbstmord und ein Mord, dazu eher lustlose Ermittler – das sind die Dinge mit denen sich Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigation in Karin Slaughters „Letzte Worte“ herumschlagen muss. Für ihn einerseits frustrierend, andererseits trifft er die verwitwete Dr. Sara Linton wieder und lernt ihre Familie kennen. Und die Leserschaft bekommt mit diesem zweiten Teil der „Georgia-Serie“ einen spannenden Thriller mit überraschendem Ausgang serviert. Was will man mehr? |
|
| Bewertung vom 04.11.2024 | ||
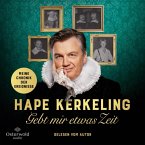
|
Als das soziale Leben in Deutschland wegen Corona etwas heruntergefahren wurde, fingen die einen an zu stricken, andere backten Bananenbrot wie die Weltmeister und Hape Kerkeling stürzte sich in die Ahnenforschung. Seine Ergebnisse hat er in seinem Buch „Gebt mir etwas Zeit“ zusammengetragen, welches ich als von ihm selbst eingelesenes Hörbuch hören durfte. Es ist ein informatives, vor allem aber auch bewegendes und berührendes Buch geworden, das ich ganz sicher noch einmal hören werde. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 28.10.2024 | ||
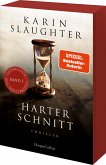
|
„Harter Schnitt“ ist der fünfte Teil von Karin Slaughters „Georgia“-Reihe um Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigation. Ursprünglich erschien das Buch 2013, jetzt liegt die Neu-Auflage vor. Für mich ganz klar nicht das beste Werk von Karin Slaughter, aber es bringt der Leserschaft die tragenden Personen der Serie etwas näher, denn Will Trent, Dr. Sara Linton, Faith Mitchell und natürlich auch Amanda Wagner sind „alte Bekannte“. |
|
| Bewertung vom 28.10.2024 | ||

|
„Es ist kompliziert“, ist mein Fazit zu „Kleine Monster“ von Jessica Lind. Zwar passt das Buch nicht so hundertprozentig zum Klappentext, aber mich hat es gepackt und berührt. Toxische, dysfunktionale Familien mit dunklen Geheimnissen – da fühle ich mich doch gleich zu Hause und abgeholt. Für mich war es ein Buch, das noch lange nachhallen wird. |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||
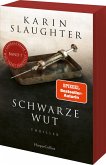
|
Als Fan der ersten Stunde habe ich „Schwarze Wut“, den fünften Teil von Karin Slaughters „Georgia-Serie“ schon bei seinem ersten Erscheinen 2013 im Original gelesen. Für mich war es wie eine Art Familientreffen, denn man begegnet nicht nur Will Trent und Sara Linton wieder, sondern auch Amanda Wagner, Faith Mitchell und (leider) auch Lena Adams. Es ist ganz sicher nicht Karin Slaughters bestes Buch, dafür fand ich es stellenweise zu komplex und verworren, aber ich habe es mit Begeisterung jetzt in der Neu-Auflage noch ein weiteres Mal gelesen. |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||
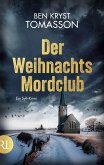
|
Zwar ist es noch ein bisschen früh für Weihnachtsstimmung und Vanillekipferl, aber ich habe mich dennoch an Ben Kryst Tomassons „Der Weihnachtsmordclub“ gewagt. So wirklich in Vorweihnachtsstimmung kam ich mit dem Buch aber auch nicht, es hat mich schlicht nicht vom Hocker gerissen. Zwar ermitteln die „Häkeldamen“, die man aus den „Sylt“-Krimis kennt, wieder einmal in einem Mordfall, die Geschichte weist aber so viele Verdächtige und Motive auf, dass ich sie hoffnungslos überladen und übertrieben fand. Da ich schon einige Bücher des Autors gelesen habe, hatte ich mehr erwartet. |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||
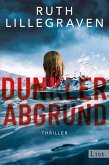
|
Kaltblütige Karrieristin geht über Leichen. So könnte man „Dunkler Abgrund“ von Ruth Lillegraven ganz kurz zusammenfassen. Wer „Tiefer Fjord“ kennt, dem ist Clara Lofthus vermutlich noch im Gedächtnis. Während der erste Teil der Reihe mich begeistert hat, konnte dieses Buch bei mir nur mäßig punkten. Die Geschichte fand ich völlig abstrus, die Spannung fehlte für mich gänzlich und die Charaktere waren samt und sonders unsympathisch und undurchsichtig. Schade, ich hatte mich auf das Buch sehr gefreut. |
|
| Bewertung vom 02.10.2024 | ||
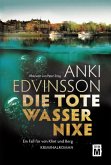
|
„Die tote Wassernixe“ ist der zweite Teil der „von Klint und Berg“-Serie von Anki Edvinsson und das erste Buch der schwedischen Autorin, das ich gelesen habe. Und, was soll ich sagen: es hat mich begeistert. Schande über mich, dass ich den ersten Teil „Der tote Schnee-Engel“ noch nicht kenne. Die Geschichte ist unglaublich spannend erzählt, vielseitig und vielschichtig konstruiert und wartet am Schluss mit einem überraschenden Paukenschlag auf. Was will man von einem Krimi mehr? |
|
| Bewertung vom 16.09.2024 | ||
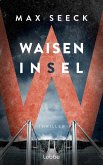
|
Waiseninsel / Jessica Niemi Bd.4 (eBook, ePUB) Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte, aber bislang kannte ich den finnischen Autor Max Seeck noch nicht. „Waiseninsel“ heißt der vierte Band seiner Serie um die Kriminalbeamtin Jessica Niemi, die in Helsinki ihren Dienst tut. Das Buch hatte auf mich eine starke Sogwirkung, einmal damit angefangen, konnte ich es nicht mehr aus der Hand legen. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht die anderen Teile der Reihe sind, „Waiseninsel“ hat mich gepackt und begeistert. |
|
