BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 945 Bewertungen| Bewertung vom 10.01.2014 | ||

|
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß Ein literarisches Labsal 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 07.01.2014 | ||
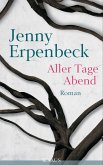
|
Der Reiz des Irrealis 4 von 7 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 29.12.2013 | ||
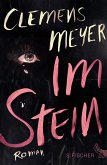
|
Pecunia non olet 2 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 21.12.2013 | ||

|
How Fiction Works 12 von 14 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.12.2013 | ||

|
Auf dem Gipfel sinnlosen Tuns 7 von 9 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.12.2013 | ||
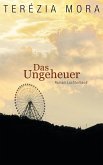
|
On the Road mit Urne und Laptop 8 von 15 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 29.11.2013 | ||
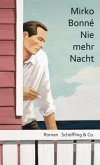
|
Bonjour Tristesse 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.11.2013 | ||

|
«Existenzerhellung» nach Karl Jaspers |
|
| Bewertung vom 21.11.2013 | ||
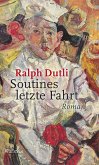
|
Manchmal kommt das Beste eben zum Schluss! |
|
