BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 100 Bewertungen| Bewertung vom 14.02.2023 | ||
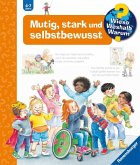
|
Wieso? Weshalb? Warum?, Band 51 - Mutig, stark und selbstbewusst Ein wichtiges Thema kindgerecht umgesetzt |
|
| Bewertung vom 11.02.2023 | ||
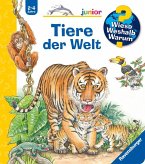
|
Tiere der Welt / Wieso? Weshalb? Warum? Junior Bd.73 Alle Erwartungen erfüllt |
|
| Bewertung vom 06.02.2023 | ||
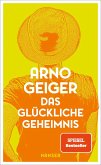
|
Die Entwicklung eines Schriftstellers 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 03.02.2023 | ||
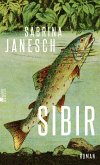
|
Wenig bekanntes Kapitel deutsch-russischer Geschichte |
|
| Bewertung vom 23.01.2023 | ||
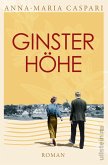
|
Fiktion und historische Fakten |
|
| Bewertung vom 20.01.2023 | ||
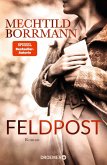
|
Historie wird lebendig |
|
| Bewertung vom 29.11.2022 | ||
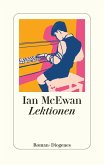
|
Ein Meisterwerk! |
|
| Bewertung vom 28.11.2022 | ||
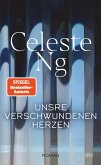
|
Eher ein Jugendbuch |
|
| Bewertung vom 28.11.2022 | ||
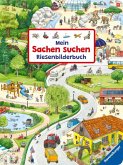
|
Mein Sachen suchen Riesenbilderbuch Wimmelbuch im XXL- Format |
|
| Bewertung vom 18.11.2022 | ||
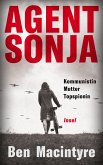
|
Packend und informativ! |
|
